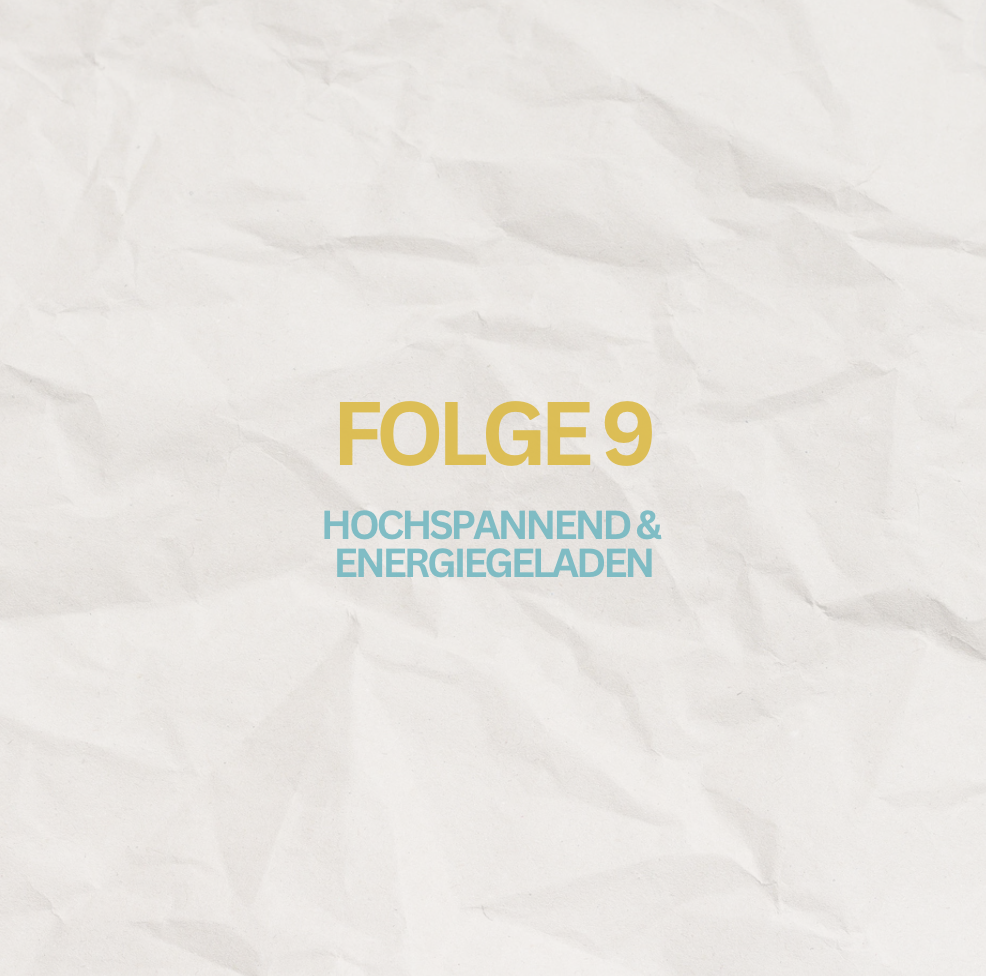Dani: So Frank, das letzte Mal ging es um Stuttgart 21. Lass uns doch mal raus aus dem Kessel und ab ins wunderschöne, windige Niedersachsen und in meine Region. Ja, hier wird ja eine Menge Strom erzeugt, der dann quer durch Deutschland geliefert wird.
Frank: Ja, moin zusammen, das stimmt. Niedersachsen ist natürlich echt geprägt durch viel Wind. Es gibt hier total viele Windanlagen auf dem Land, aber auch natürlich offshore, also auf dem Meer. Und da wird ordentlich Wind erzeugt. Und es gibt jetzt auch ein neues Gesetz und wir streben in Niedersachsen jetzt gerade ungefähr zwei Prozent der Fläche für die Erzeugung von erneuerbaren Energien an. Das ist total wichtig und das funktioniert, wenn es denn da nicht ein, sagen wir mal, kleines Planungsparadoxon gäbe.
Denn ein ähnliches nationales Projekt, das vielleicht eine ähnliche Wirkung hat wie Stuttgart 21, sind nämlich die ganzen Stromtrassen. Das sind Hochspannungsleitungen, der Strom wird in Niedersachsen erzeugt und geht dann zum Beispiel nach Bayern oder in andere Länder. Das sind diese wirklich großen Leitungen. Das sind Stromautobahnen und die sind total wichtig. In Niedersachsen gibt es zum Beispiel Südlink und Südostlink. Die sind Teil der Energiewende und wir brauchen diese Trassen, um die Umstellung auf erneuerbare Energien in Deutschland, das wurde ja vor Jahren beschlossen, als neulich dieses Atomkraftwerk in Fukushima in Deutschland geflogen ist.
Wir bauen also die Stromversorgung in Deutschland um und diese Stromtrassen sind zentrale Infrastrukturprojekte, um den Windstrom aus dem Norden in den südlichen Teil Deutschlands zu transportieren.
Dani: Also der Bedarf für eine neue Strominfrastruktur wurde an sich rechtzeitig angekündigt. Ja. Und ich glaube über die generelle Notwendigkeit im Kontext der Energiewende müssen wir wohl nicht sprechen, oder?
Frank: Nein.
Dani: Also es ging ja dann um die konkrete Trassenführung. Und genau hier kam es ja dann teilweise zu großem Widerstand in der betroffenen Bevölkerung.
Frank: Und das ist ja immer so ein Klassiker. Also zu Hause würde der Strom aus der Steckdose kommen und am besten auch keinen Müll verursachen und die Überbleibsel unseres, sagen wir mal, Erstweltlebens, die werden dann irgendwo anders verklappt.
Dani: Ja und hier ist auch wieder ein Thema der Kommunikation. Einige Bürgerinitiativen und auch die lokalen Akteure die fühlten sich einfach übergangen und nicht ausreichend informiert. Und als es dann eben um diese konkrete Trassenführung ging, also der genaue Verlauf, dann wusste man ganz genau, wo kommt was hin. Und hier sind ja dann die Auswirkungen auf die lokalen Gemeinden und auch natürlich auf die empfindlichen Naturräume, die wir hier haben.
Und dann kommt natürlich der Unmut. Eher auch total verständlich, weil eben nicht ausreichend informiert, Kommunikation mangelhaft. Ja und dieser Widerstand manifestierte sich in öffentlichen Protesten, Einwendungen während der nachfolgenden Planfeststellungsverfahren.
Frank: Das stimmt. Jetzt zeigt sich das Paradoxon, dass obwohl die generelle Notwendigkeit eines Projekts anerkannt wird, die konkrete Umsetzung vor Ort auf heftigen Widerstand stoßen kann, wenn die Anwohner und Anwohnerinnen sich nicht rechtzeitig und ausreichend einbezogen fühlen. Das ist wichtig. Es geht um das Wort fühlen. Die werden ja informiert, fühlen sich aber abgeholt.
Dani: Ja, Kommunikation, das Unikat in Kommunikation. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, denn auch hier, nur weil wir einmal was sagen oder sagen, das haben wir doch schon sieben Mal erzählt. Wenn wir sieben Mal auf die gleiche Art und Weise erzählen, dann ist das einmal. Und genau das, was du sagst, sie fühlen sich nicht abgeholt, sie fühlen sich nicht mitgenommen.
Das heißt, hier muss man natürlich auch überlegen, wie kann dann frühzeitig, sehr offen und auch regelmäßig informiert werden mit allen Stakeholdern. Man muss ja überlegen, wer sind die verschiedenen Zielgruppen? Wie erreichen wir die? Wie können wir das Ganze einfach auch ein bisschen transparenter darstellen, also den ganzen Planungsprozess? Und dann bekommt man natürlich die Akzeptanz und im besten Fall wirken die sogar mit und sagen, hey, ich habe da noch einen Gedanken, ich habe da noch eine Idee, wir könnten noch das und das machen. Und dann, finde ich, hat man einfach ein effektives und bürgerorientiertes Projektmanagement.
Frank: Genau. Und zum Beispiel bei diesen großen Infrastrukturvorhaben, also Südlink, diese Stromtrassen, die die erneuerbaren Energien von den Windkraftanlagen im Norden, in den Süden und Westen Deutschlands transportieren sollen, da gab es gleich mehrere Herausforderungen. Zum Beispiel ein Kommunikationsdefizit.
Die Einwohner in den betroffenen Gebieten haben sehr oft bemängelt, dass die Informationen zu den konkreten Trassenplänen nicht früh genug oder nicht umfassend genug kommuniziert wurden. Und deswegen gab es Unsicherheit und auch Unmut in der Bevölkerung. Dann fühlten sich die Bürger viel zu spät nochmal unzureichend oder gar nicht in die Planungsprozesse einbezogen.
Das sind mündige Bürger, die halten sich dafür, da sind sie auch. Und dann soll man sie auch ernst nehmen und einfach mal mit auf die Reise nehmen. Und dann haben wir natürlich auch noch die Schere zwischen den lokalen Interessen und den nationalen Zielen. Also, wenn man sich mal vorstellt, die übergeordnete Bedeutung der Energiewende ist wichtig und die ist total strategisch für ganz Deutschland. Und auf einmal hat man aber hier die lokalen Interessen und Bedenken wie Landschaftsschutz, Tourismus und natürlich auch die Verwendung von landwirtschaftlichen Flächen. Und das kommt dann einfach in Konflikt mit dem Planung.
Weiter geht es zum Beispiel mit dem Dilemma Naturschutz. Da gibt es natürlich auch Bedenken. Natur ist immer empfindlich. Und wenn man da einfach so eine Trasse durchzieht, das ist nicht einmal nur der Baulärm, der dann über Jahre die Natur kaputt macht, sondern von diesen Trassen geht ja auch eine Störung des Gleichgewichts aus. Und wenn man jetzt noch, wenn man jetzt noch geschafft hätte, die Notwendigkeit dieser technischen Technik, also dieser technischen Veranstaltung richtig zu kommunizieren, dann hätte man vielleicht festgestellt, dass zum Beispiel die unterirdische Trasse, die ja häufig auch einfach so mal gefordert wird, das Ding sieht man nicht, ist weg. Diese unterirdische Trasse zum Beispiel ist total teuer, hat ähnliche Strahlungswerte und da wäre der Bau noch länger gewesen.
Und deswegen, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern von Anfang an erklärt, das ist zu teuer, das dauert noch länger und funktioniert dann eh nicht gut oder schlecht, da hätte die Politik einfach viel transparenter, viel besser agieren können und müssen.
Dani: Absolut. Ich würde gerne nochmal so die, ja mal zusammenfassen, was man hätte besser machen können. Kommunikation – haben wir jetzt schon viel darüber gesprochen, über einen langen Zeitraum hinweg. Die Information nutzen, nutzen Ziele, was bringt das? Ich sage immer, what’s in for me? Auch ganz wichtig, was ist für mich da drin? Wir wollen ja schon wissen, was bringt mir das auf? Und ich glaube, damit hätte man auch die Missverständnisse frühzeitig verhindern können. Wichtig, die Menschen mit einzubeziehen, Betroffene zu beteiligen machen.
Ja, Politik, die hätte Mechanismen zur aktiven Mitwirkung der Bürger etablieren können. Ja, es gibt natürlich einerseits die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren, wo muss man das machen? Ich habe da mal was angeschlagen, habt ihr doch alle gesehen. Das ist das eine.
Frank: Man kann aber auch nochmal serviceorientiert einen Schritt weitergehen.
Dani: Unbedingt. Man könnte zum Beispiel Bürgerforen schaffen. Workshops, finde ich auch mal richtig cool. Das muss ja auch nicht immer ewig lang und viel sein. Man kann ja auch mal so Impuls-Workshops machen und sagen, hey, wer hat da Lust zu, wer möchte da mal mitarbeiten? Das können aber so Planungszellen, so Arbeitsgruppen mit Experten vor Ort geben, also echte Experten. Nicht die sagen, ich bin Experte, sondern Menschen vor Ort, die halt auch zum Beispiel betroffen sind, die sich mit dem Naturschutz auskennen, die mit der Landwirtschaft, was für Auswirkungen kann das haben auf Land, Leben, auf Tiere? Also sowas. Und die hätte man natürlich im Vorfeld viel, viel mehr aktiv mit einbeziehen können. Dann könnte man sich natürlich überlegen, wo kann man diese Informationen, wenn man sie dann in Workshops und Sonstiges erarbeitet hat beispielsweise, wo könnte man die hinstellen? Wo sind die Menschen? Wo lesen die? Wo informieren die sich? Einfach hier mal zu gucken.
Vielleicht gibt es dann auch so eine fahrende Ausstellung. Wie so eine Roadshow. Ja, Roadshow. Mag ich auch immer sehr. Genau. Man fährt einfach ein bisschen durch die Gegend und könnte das ja irgendwie verbinden mit irgendwas anderem. Dann gibt es so eine fahrende Bibliothek und so was. Mal gucken, was gibt es denn auch? Wo könnte man das noch ergänzen? Was wird von den Bürgern angenommen? Mensch, da kann ich schon lange drüber reden. Ja, und wir haben ja auch immer wieder das Konfliktpotenzial, haben wir auch schon öfters gehabt, auch mal bei Stuttgart 21. Wir erinnern uns an nicht nur den Dialog, sondern auch dann an die Mediation, denn es darf ja natürlich auch Konflikte geben. Und das ist wichtig. Wir dürfen da auch einfach mal drüber sprechen und dann müssen wir gucken, dass wir das eben auch moderieren und gucken, dass es jetzt um die Sache geht. Das ist auch ganz wichtig. Wir müssen gucken, dass wir bei der Sache sind und ich bin selber auch ein sehr emotionaler Mensch. Von daher weiß ich, dass es auch gut ist, wenn man dann Mediation betreibt. Ich durfte das auch in vielen Gruppen machen und das ist sehr hilfreich, immer wieder zu sagen, wir gehen jetzt mal da raus, wir zoomen da raus und insofern ganz wichtiger Punkt.
Ich habe vorhin auch über die Umwelt gesprochen. Umwelt auch hier zu gucken, wurde das denn ordentlich geprüft? Gibt es noch ökologische Bedenken? Wurden die ernst genommen? Also allein die Bürger und Bürgerinnen machen sich ja vielleicht Gedanken darüber und vielleicht wurde das ja auch gemacht, aber vielleicht wurde nicht darüber gesprochen, dass es das alles gegeben hat. Und was ich auch immer gut finde, wenn wir denn so Sachen haben, egal welche Information, dieses Warum, was ist für mich drin, warum brauchen wir das jetzt, warum nicht erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren, warum brauchen wir das jetzt, dass wir das vielleicht auch ein bisschen mal anders darstellen, mal ein bisschen visualisieren. Vielleicht gibt es Grafiken, Filme, vielleicht auch ein Podcast. Wir dürfen ja hier gerne moderner denken. Muss ja jetzt hier nicht gleich irgendwie die Verwaltung auf TikTok rumspringen. Gleichzeitig sollten wir natürlich gucken, wo erreichen wir die Menschen und wie erreichen wir sie auch mit ihrer Tonalität.
Frank: Ja, wir sind nicht mehr im alten Rom, wo man die Akta Urbis in einen Stein gekloppt hat, um allen Bürgerinnen und Bürgern irgendwas zu erklären von oben herab.
Dani: Absolut. Also Zeiten sind vorbei. Es gibt so viele Sachen, auch hier hätte, hätte, aber gut. Wir merken wieder mal, es ist so wichtig, dass wir mehr miteinander reden, dass wir transparent kommunizieren und dass wir mit allen Menschen ins Gespräch kommen.
Frank: Das ist nicht nur so wichtig, das ist auch so einfach.
Dani: Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht.
Frank: Genau, denn: Stell dir das Planungs-Paradoxon wie ein Restaurant vor – das „Zum Goldenen Spaten“. Dieses Restaurant ist berühmt für seine kunstvoll gestalteten Speisekarten und jahrelangen Ankündigungen von revolutionären Gerichten, die die Gäste begeistern sollen. Der Chefkoch und Eigentümer, Herr Planung, hat eine Vision: „Die kulinarische Revolution!“, ruft er jederzeit aus, wenn er gefragt wird. So entwirft er ein exquisites Menü – der „Bahnhof Bourguignon“ und die „Autobahn al dente“ sind die Herzstücke der Karte. Jedes Gericht ist garniert mit Versprechungen von organischem Wachstum und nachhaltigem Genuss. Die Zubereitung dieser Gerichte sollte eigentlich im offenen Show-Küchenstil stattfinden, damit die Gäste jeden Schritt nachvollziehen können. Doch stattdessen hängt ein riesiger Vorhang vor der Küche, und ab und zu huschen Kellner mit Probiertellern heraus, auf denen mal etwas Leckeres, mal etwas Seltsames liegt – nie aber das, was auf der Karte steht. Die Stammgäste, die Einwohner der nahen Siedlung „Bürgerhausen“, sind irritiert. Denn obwohl Herr Planung seine Ideen und Menüs in der Lokalzeitung auflistet, ist ihm entgangen, dass die meisten Bürger noch immer auf die altmodische Dorfpost angewiesen sind – digital lesen die da höchstens die Speisekarten von anderen Restaurants. Als eines Tages laute Geräusche aus der Küche andeuten, dass mit dem revolutionären Kochen begonnen wurde, marschieren die Einwohner von „Bürgerhausen“ verwirrt zum „Zum Goldenen Spaten“. „Was ist mit dem guten alten Schnitzel passiert?“ fragen sie. Herr Planung winkt ab und zeigt auf das Menü: „Seht doch, der ‚Bahnhof Bourguignon‘ wird alles ändern!“
Aber die Gäste schauen auf den Bagger auf dem nahen Marktplatz, der gerade Beginn ist, ihre liebgewonnenen Parkplätze umzugraben, und murmeln: „Da steht doch nur ‚Wird serviert in naher Zukunft’… und das Datum hier, das war doch letztes Jahr!“
Dani: Ja, und beim nächsten Mal, Frank, gib uns vielleicht mal ein paar kürzere und prägnantere Beispiele. Und nein, kann heute auch nicht mehr. In diesem Sinne freuen wir uns auf kurze, spannende weitere Beispiele aus dem lustigen Kabernett der Planungsparadoxen, oder?
Frank: Ja, genauso ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.