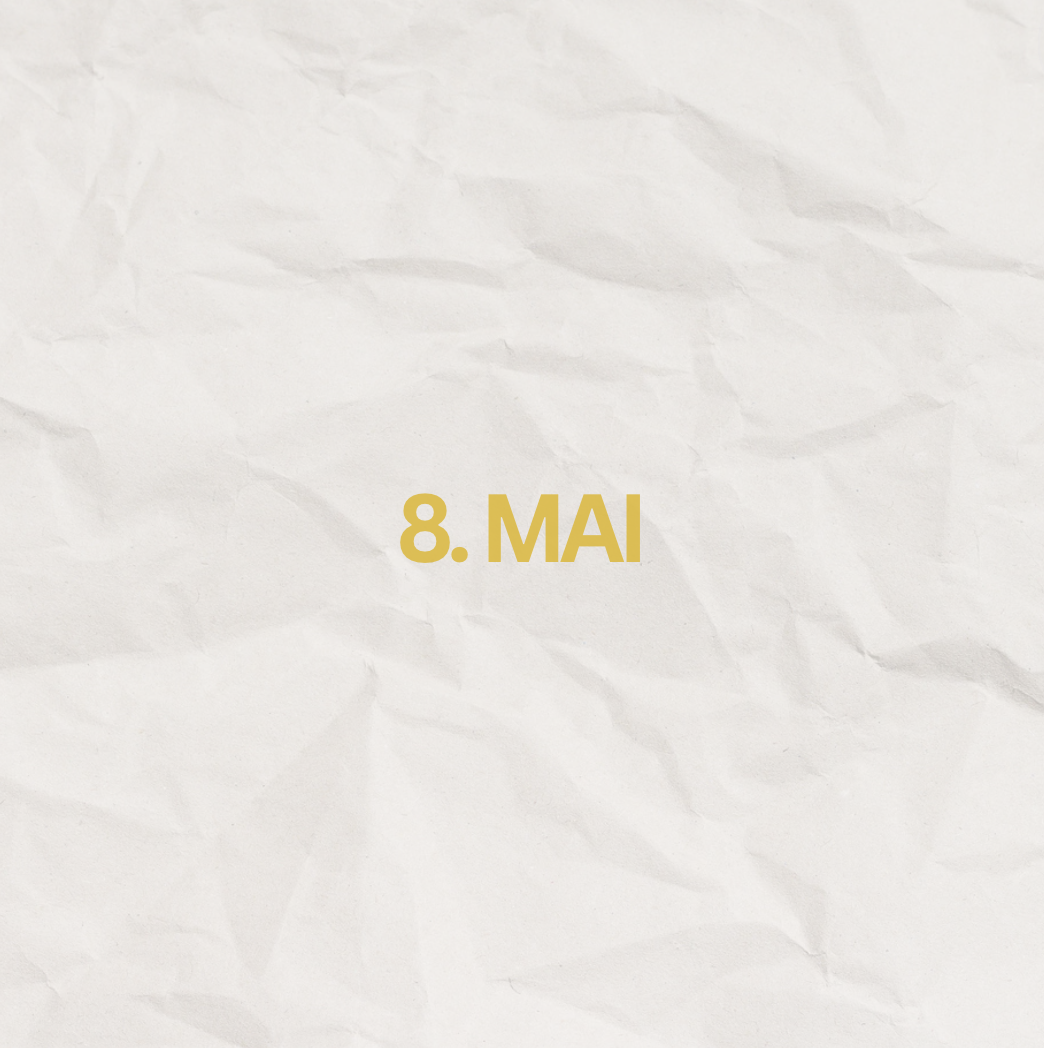Der 8. Mai 1945 markiert das Ende einer der dunkelsten Epochen der deutschen und europäischen Geschichte. Um die Bedeutung dieses Tages als „Tag der Befreiung“ zu verstehen, ist es unerlässlich, einen Blick auf die Vorgeschichte zu werfen, die mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 begann.
Am 30. Januar 1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg Adolf Hitler zum Reichskanzler. Dies war der Beginn einer Diktatur, die Deutschland und Europa in den Abgrund führen sollte. Der renommierte deutsche Historiker Hans-Ulrich Wehler beschreibt diesen Moment als „Beginn einer Herrschaft des Schreckens und der Vernichtung“. Die Nationalsozialisten begannen umgehend mit der Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Bereiche und der Verfolgung politischer Gegner.
Mit dem Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 wurde die Weimarer Verfassung de facto außer Kraft gesetzt. Der britische Historiker Ian Kershaw betont: „Mit diesem Schritt war der Weg in die totalitäre Diktatur geebnet.“ In den folgenden Jahren errichteten die Nationalsozialisten ein Terrorregime, das auf Rassismus, Antisemitismus und Expansionismus basierte.
Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, der Sinti und Roma, sowie anderer als „minderwertig“ bezeichneter Gruppen, erreichte mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 eine neue Dimension. Der deutsche Rechtshistoriker Michael Stolleis charakterisiert diese Entwicklung als „Übergang von der Diskriminierung zur systematischen Vernichtung“.
Der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg führte zu unvorstellbarem Leid und Zerstörung in ganz Europa. Die deutsche Historikerin Ulrike Jureit beschreibt die Kriegsjahre als „eine Zeit der extremsten Gewalt und des Völkermords“. In den besetzten Gebieten errichteten die Nationalsozialisten ein Regime des Terrors, das Millionen von Menschen das Leben kostete.
Mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 endete schließlich die nationalsozialistische Herrschaft. Der britische Historiker Richard J. Evans bezeichnet diesen Tag als „Wendepunkt der europäischen Geschichte“. Für die Millionen von Menschen, die unter der NS-Herrschaft gelitten hatten, bedeutete er tatsächlich Befreiung.
Doch die Deutung des 8. Mai als „Tag der Befreiung“ setzte sich in Deutschland erst allmählich durch. Der deutsche Rechtshistoriker Joachim Rückert erklärt: „Für viele Deutsche war es zunächst ein Tag der Niederlage. Die Erkenntnis, dass es auch für Deutschland selbst ein Tag der Befreiung war, brauchte Zeit.“
Ein Meilenstein in diesem Prozess war die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes im Jahr 1985. Er erklärte: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“
Diese Sichtweise hat sich inzwischen weitgehend durchgesetzt. Der Historiker Heinrich August Winkler betont: „Der 8. Mai 1945 war nicht nur das Ende des NS-Regimes, sondern auch der Beginn einer neuen Epoche der deutschen Geschichte, die auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und europäische Integration ausgerichtet war.“
Dennoch bleibt die Erinnerung an den 8. Mai 1945 komplex. Die britische Historikerin Mary Fulbrook weist darauf hin: „Für viele Deutsche war es ein Tag gemischter Gefühle – Erleichterung über das Ende des Krieges, aber auch Trauer über persönliche Verluste und Unsicherheit über die Zukunft.“
Der 8. Mai als „Tag der Befreiung“ erinnert uns heute an die Schrecken des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, aber auch an den Neuanfang, der damit möglich wurde. Er mahnt uns, wachsam zu bleiben gegenüber antidemokratischen und menschenfeindlichen Tendenzen und die Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten zu verteidigen.
Der deutsche Verfassungsrechtler Christoph Möllers fasst die bleibende Bedeutung des 8. Mai so zusammen: „Er ist ein Tag, der uns daran erinnert, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern errungen und verteidigt werden müssen.“
In diesem Sinne ist der 8. Mai nicht nur ein Tag des Gedenkens an die Vergangenheit, sondern auch ein Auftrag für die Gegenwart und die Zukunft.
Der 8. Mai bis in die 1960er Jahre
Der 8. Mai, der Tag des Kriegsendes und der Befreiung vom Nationalsozialismus, wurde in der Bundesrepublik Deutschland bis in die 1960er Jahre weitgehend verschwiegen und nicht offiziell begangen. Dies hatte mehrere tiefgreifende Gründe, die eng mit den gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Nachkriegszeit verknüpft waren.
Für viele Deutsche war der 8. Mai 1945 zunächst mit traumatischen Erlebnissen wie Niederlage, Zerstörung, Flucht und Vertreibung verbunden. Es überwogen oft Gefühle von Scham, Schuld und Trauer. Der Historiker Norbert Frei beschreibt diese Phase als eine Zeit, in der die deutsche Gesellschaft „die unmittelbaren Folgen des Krieges und der nationalsozialistischen Herrschaft zu bewältigen versuchte, ohne sich intensiv mit den Ursachen und Verbrechen des Regimes auseinanderzusetzen“. Diese traumatischen Erfahrungen führten zu einer weit verbreiteten Tendenz, die Verbrechen des NS-Regimes zu verdrängen und sich selbst als Opfer zu sehen.
Der Fokus der Nachkriegsgesellschaft lag stark auf dem wirtschaftlichen Wiederaufbau und der Westintegration. Eine intensive Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit hätte diesen Prozess möglicherweise gestört. Der Historiker Heinrich August Winkler betont, dass „die wirtschaftliche Erholung und die politische Stabilisierung der jungen Bundesrepublik Vorrang hatten und eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zunächst in den Hintergrund trat“.
Im Kontext des Kalten Krieges wurde die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus teilweise als hinderlich für den Kampf gegen den Kommunismus gesehen. Der Historiker Andreas Wirsching erläutert: „In der bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges wurde die Bundesrepublik als Bollwerk gegen den Kommunismus betrachtet, was eine umfassende Aufarbeitung der NS-Zeit erschwerte.“
Ein weiterer Faktor war die personelle Kontinuität in Verwaltung, Justiz und anderen Bereichen. Viele Personen, die im NS-System Funktionen innehatten, blieben in ihren Positionen, was eine offene Aufarbeitung erschwerte. Der Jurist und Historiker Michael Stolleis beschreibt diese Kontinuitäten als „eine der größten Herausforderungen für die junge Demokratie, die sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen musste“.
Es gab noch keine etablierte Erinnerungskultur und kaum öffentliche Diskurse über die NS-Zeit und deren Aufarbeitung. Der Historiker Norbert Frei spricht von einer „Vergangenheitspolitik“, in der eine „Kombination aus Amnestie und Integration“ vorherrschte. Erst mit dem Generationenwechsel und den gesellschaftlichen Umbrüchen der 1960er Jahre begann eine intensivere Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und eine Neubewertung des 8. Mai.
Ein Wendepunkt in der offiziellen Erinnerungskultur der Bundesrepublik war die Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum 40. Jahrestag des Kriegsendes 1985. In dieser Rede bezeichnete er den 8. Mai als „Tag der Befreiung“ und betonte, dass dieser Tag „uns alle befreit hat von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“. Diese Rede markierte einen wichtigen Schritt hin zu einer offenen und kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und einer Anerkennung des 8. Mai als Tag der Befreiung.
Heute wird der 8. Mai in Deutschland als Tag des Gedenkens und der Mahnung begangen. Er erinnert an die Schrecken des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, aber auch an den Neuanfang, der damit möglich wurde. Der Verfassungsrechtler Christoph Möllers fasst die bleibende Bedeutung des 8. Mai so zusammen: „Er ist ein Tag, der uns daran erinnert, dass Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeiten sind, sondern errungen und verteidigt werden müssen.“
Von Versailles bis zur Machtergreifung
Das nationalsozialistische Regime in Deutschland, das von 1933 bis 1945 herrschte, war das Ergebnis einer komplexen Entwicklung, die ihre Wurzeln in den Nachwehen des Ersten Weltkriegs und den Schwierigkeiten der Weimarer Republik hatte.
Der Versailler Vertrag, der den Ersten Weltkrieg formal beendete, spielte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Nationalsozialismus. Wie der Historiker Gerd Krumeich betont, wurde der Vertrag „von den meisten Deutschen als ungerecht empfunden und von rechtsstehenden Kreisen als ‚Versailler Diktat‘ geschmäht“. Die harten Bedingungen des Vertrags, einschließlich territorialer Verluste, Reparationszahlungen und Rüstungsbeschränkungen, schufen ein Klima der Verbitterung und des Revanchismus in Deutschland.
Die Weimarer Republik, Deutschlands erste Demokratie, wurde in diesem schwierigen Umfeld geboren. Trotz einiger Erfolge in den 1920er Jahren war sie von Anfang an mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Der Historiker Heinrich August Winkler erklärt, dass „die wirtschaftliche Erholung und die politische Stabilisierung der jungen Republik Vorrang hatten“, was eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zunächst in den Hintergrund treten ließ. Die Weltwirtschaftskrise ab 1929 verschärfte die Probleme der Republik und schuf ein Klima der Unsicherheit und Unzufriedenheit.
In diesem Kontext gelang es der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) unter Adolf Hitler, an Popularität zu gewinnen. Wie der Historiker Ian Kershaw hervorhebt, konnte der Nationalsozialismus „an bestimmte, weit verbreitete Vorstellungen und Traditionen in der politischen Kultur zurückgreifen“. Die NSDAP präsentierte sich als radikale Alternative zum bestehenden System und versprach, die „Schmach von Versailles“ zu tilgen und Deutschland zu alter Größe zurückzuführen.
Die sogenannte „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten begann mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. Der Historiker Michael Grüttner beschreibt, dass „nach der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 kaum jemand daran zweifelte, dass die Weimarer Republik der Vergangenheit angehörte“. In den folgenden Monaten konsolidierten die Nationalsozialisten ihre Macht durch eine Kombination aus Terror, Propaganda und legalen Maßnahmen.
Ein entscheidender Schritt war das Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933, das Hitler de facto diktatorische Vollmachten verlieh. Der Rechtshistoriker Michael Stolleis charakterisiert diesen Moment als „Übergang von der Diskriminierung zur systematischen Vernichtung“ politischer Gegner und unerwünschter Gruppen.
In den folgenden Jahren errichteten die Nationalsozialisten ein totalitäres Regime, das alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens durchdrang. Der Historiker Norbert Frei beschreibt diese Phase als eine Zeit, in der „die deutsche Gesellschaft einer rigiden Gleichschaltung mit dem Anspruch unterworfen war, das öffentliche und private Leben mit NS-Ideologie zu durchdringen“.
Es ist wichtig zu betonen, dass das NS-Regime, trotz seiner Brutalität und seines Terrors, auf breite Unterstützung in der deutschen Bevölkerung zählen konnte. Wie der Historiker Ulrich Herbert feststellt, war es „letztlich die Masse der ‚ganz normalen Deutschen‘, die vom Regime profitierte und es dadurch stützte“.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten und die Errichtung ihrer Diktatur markieren einen tiefen Einschnitt in der deutschen Geschichte. Sie führten nicht nur zu unvorstellbarem Leid und Millionen von Toten im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust, sondern hinterließen auch tiefe Narben in der deutschen Gesellschaft, die bis heute nachwirken. Die kritische Auseinandersetzung mit dieser Zeit bleibt eine wichtige Aufgabe für Historiker und die Gesellschaft als Ganzes.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 ergriffen sie rasch eine Reihe von Maßnahmen, um ihre Herrschaft zu festigen und einen totalitären Staat zu errichten. Diese Maßnahmen reichten von der Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Bereiche über die Verfolgung politischer Gegner bis hin zur Nutzung intensiver Propaganda.
Ein zentrales Element der nationalsozialistischen Herrschaft war die Gleichschaltung. Die Nationalsozialisten begannen umgehend, alle gesellschaftlichen Bereiche unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Historiker Norbert Frei beschreibt diesen Prozess als „rigide Gleichschaltung mit dem Anspruch, das öffentliche und private Leben mit NS-Ideologie zu durchdringen“. Dies beinhaltete die Auflösung von Vereinen und Verbänden sowie die Kontrolle über Medien, Kultur und Bildung. Die Nationalsozialisten wollten sicherstellen, dass alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens im Einklang mit ihrer Ideologie standen.
Parallel zur Gleichschaltung setzten die Nationalsozialisten auf Terror und Verfolgung, um ihre Macht zu sichern. Politische Gegner und unerwünschte Gruppen wurden systematisch verfolgt und unterdrückt. Die SA (Sturmabteilung) spielte dabei eine wichtige Rolle, indem sie im Straßenbild präsent war und Einschüchterung betrieb. Der Rechtshistoriker Michael Stolleis charakterisiert diese Phase als „Übergang von der Diskriminierung zur systematischen Vernichtung“ politischer Gegner.
Ein entscheidender Schritt zur Festigung der nationalsozialistischen Herrschaft war das Ermächtigungsgesetz, das am 23. März 1933 verabschiedet wurde. Dieses Gesetz verlieh Adolf Hitler de facto diktatorische Vollmachten und ermöglichte es ihm, ohne parlamentarische Kontrolle zu regieren. Der Historiker Heinrich August Winkler betont die Bedeutung dieses Gesetzes: „Mit dem Ermächtigungsgesetz war der Weg in die totalitäre Diktatur geebnet.“
Die Nationalsozialisten nutzten auch intensive Propaganda, um die Bevölkerung für sich zu gewinnen und ihre Herrschaft zu legitimieren. Hakenkreuzfahnen und Hitler-Porträts wurden allgegenwärtig, und die Medien wurden gleichgeschaltet, um die nationalsozialistische Ideologie zu verbreiten. Der Historiker Ian Kershaw erklärt: „Die Propaganda der Nationalsozialisten war darauf ausgerichtet, die Bevölkerung zu mobilisieren und die Unterstützung für das Regime zu sichern.“
Um Zustimmung in der Bevölkerung zu gewinnen, setzten die Nationalsozialisten auf wirtschaftliche Maßnahmen wie Arbeitsbeschaffungsprogramme und Rüstungsprojekte. Diese Maßnahmen führten zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit und verschafften dem Regime breite Unterstützung. Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze beschreibt diese Strategie als „wirtschaftliche Mobilmachung zur Sicherung der nationalsozialistischen Herrschaft“.
Die Nationalsozialisten gründeten zudem zahlreiche Massenorganisationen, die das Alltagsleben der Deutschen prägten und zur „geistigen Mobilmachung“ beitragen sollten. Organisationen wie die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel sollten die Jugend im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie erziehen und indoktrinieren. Der Historiker Detlev Peukert betont die Bedeutung dieser Organisationen: „Die Massenorganisationen der Nationalsozialisten waren ein zentrales Instrument zur Durchdringung der Gesellschaft mit ihrer Ideologie.“
Ein weiteres wichtiges Element der nationalsozialistischen Herrschaft war die Propagierung der „Volksgemeinschaft“-Ideologie. Die Nationalsozialisten propagierten das Ideal der „Volksgemeinschaft“, das klassenkämpferische Parolen ersetzen und soziale Unterschiede überbrücken sollte. Der Historiker Ulrich Herbert erklärt: „Die Idee der Volksgemeinschaft war darauf ausgerichtet, die Gesellschaft zu homogenisieren und die Unterstützung für das Regime zu sichern.“
Diese Maßnahmen führten dazu, dass die Nationalsozialisten innerhalb kurzer Zeit ihre Macht konsolidieren und einen totalitären Staat errichten konnten. Der Historiker Richard J. Evans betont: „Die Kombination aus Terror, Propaganda und wirtschaftlicher Mobilmachung ermöglichte es den Nationalsozialisten, ihre Herrschaft schnell und effektiv zu festigen.“
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Nationalsozialisten nach ihrer Machtergreifung eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um ihre Herrschaft zu festigen und einen totalitären Staat zu errichten. Diese Maßnahmen reichten von der Gleichschaltung und Verfolgung politischer Gegner über die Nutzung intensiver Propaganda bis hin zur wirtschaftlichen Mobilmachung und der Schaffung von Massenorganisationen. Die Kombination dieser Maßnahmen ermöglichte es den Nationalsozialisten, ihre Macht schnell und effektiv zu konsolidieren und ihre totalitäre Herrschaft zu etablieren.