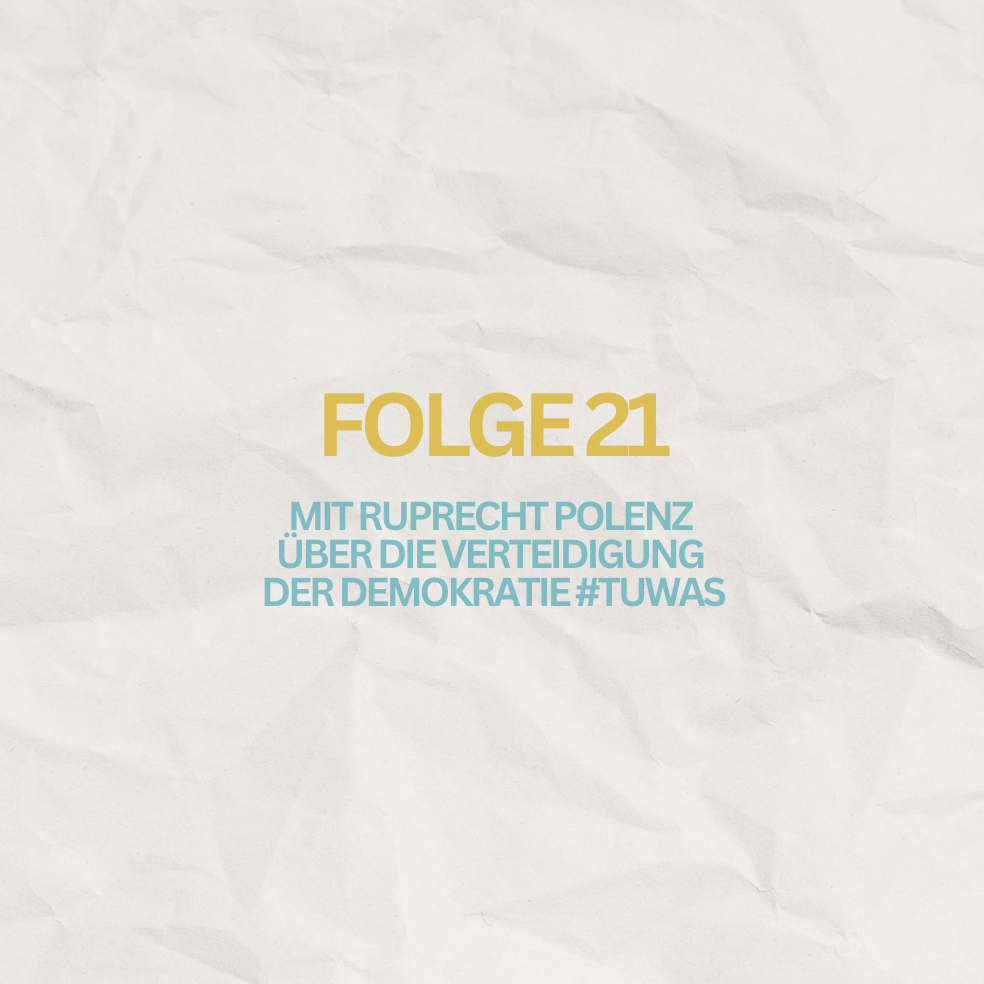Frank: Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns in der Sendung. Und zwar ist das Herr Ruprecht Polenz. Wollen Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz vorstellen?
Ruprecht Polenz: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Den Namen, wie gesagt, Ruprecht Polenz. Ich war bis 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag, die ganze Zeit im Auswärtigen Ausschuss. Und die letzten acht Jahre war ich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Davor war ich 20 Jahre Mitglied im Rat der Stadt Münster als ehrenamtlicher Kommunalpolitiker. Vom Beruf bin ich Jurist und war lange Zeit bei der Industrie- und Handelskammer in Münster beschäftigt, als Geschäftsführer für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das ist sozusagen der eine Teil. Der andere ist, ich bin verheiratet, wir haben vier Kinder, neun Enkel. Und ich lebe in Münster, wo ich 1968 zum Studium hingekommen bin. Und bei Beginn des Studiums in dieser 68er-Zeit habe ich dann angefangen, mich hochschulpolitisch zu engagieren. Und das war jetzt im Rückblick wahrscheinlich die entscheidende Weichenstellung für alles, was nachher später gekommen ist. Denn eigentlich wollte ich Anwalt werden und hatte mit Politik im engeren Sinne gar nicht so viel am Hut.
Dani: Ja, vielen Dank. Ja, ich würde direkt mal überleiten, Sie bezeichnen sich ja selbst als Demokratie-Influencer.
Ruprecht Polenz: Nee, wenn ich da gleich einhaken darf. Also ich nehme die Bezeichnung jetzt so an, weil es irgendwie üblich ist. Ich muss gestehen, ich bin jetzt 78, ich hatte mit diesem Influencer-Begriff erst mal schon ein bisschen Probleme. Aber das ist schon in Ordnung. Nur ich selber würde mich jetzt nicht so bezeichnen. Ich suche eigentlich kein Etikett.
Dani: Dann sind Sie bekannt als Demokratie-Influencer. Dann nehmen wir das mal so. Und ja, es passiert natürlich auch genau einfach sehr viel in den sozialen Medien. Und plötzlich wird man zu so einem Demokratie-Influencer, ob man das möchte oder nicht. Gleichzeitig ist es natürlich schön, weil Sie auch Einfluss haben in den sozialen Medien. Und wie nutzen Sie die denn, um Menschen für politisches Engagement zu begeistern?
Ruprecht Polenz: Ja, vielleicht erzähle ich erst mal, wie ich dazu gekommen bin. Wie gesagt, ich war im Bundestag und stellte dann irgendwann fest, die Menschen verbringen immer mehr Zeit in Social Media. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was sie da machen. Und als Abgeordneter möchte man ja schon und sollte sich auch darum kümmern, dass man die Lebenswirklichkeit der Menschen, die man vertreten darf, auch einigermaßen kennt. Deshalb macht man Unternehmensbesuche oder geht auch mal bei der Bahnhofsmission vorbei. Und deshalb habe ich mir dann einen Account von meinem Sohn einrichten lassen auf Facebook. Hab dann erst mal da so reingeguckt und dann irgendwann angefangen mitzudiskutieren. Das war die Zeit, wo dieses rassistische Buch von Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, erschienen war. Und entsprechend heftig waren dann die Diskussionen im Netz. Und weil ich eben auch als Politiker vielleicht einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte, hatte ich dann diese 5000 Facebook-Follower relativ schnell voll und gemerkt, man hat da doch eine Reichweite. Das ist jetzt für jemanden, der vorher sozusagen nur Analogpolitik gemacht hat, schon interessant. Denn wenn ich in Münster eine Veranstaltung gemacht habe zur Außenpolitik und ich kam dann nach Hause, meine Frau hat gefragt, wie war es denn? Da sag ich, war gut, war gut besucht, 40 Leute. Und das ist für eine außenpolitische Veranstaltung, ist das eine Menge. In der Kommunalpolitik hat man auch schon mal 100 Leute da, wenn die sich über irgendeine Straße oder so aufregen. Aber bei der Bundespolitik kann man da mit dem ganz zufrieden sein. Und man stellt halt fest, auf Facebook hat man sofort Hunderte. Und jetzt bin ich auf X seit ein paar Jahren und da gehen die Views in die Millionen. Und ich habe jeden Tag 2.500 Kommentare allein zu dem, was ich da mache. Und das signalisiert schon, ich kann einen größeren Kreis erreichen. Die setzen sich mit dem auseinander, was ich schreibe. Und auf diese Weise wirke ich ein Stück weit an der politischen Meinungsbildung mit. Und da vielleicht letzter Satz zu der Rolle von Social Media in diesem Kontext. Sie sind wie so eine Art Durchlauferhitzer für die Bildung der öffentlichen Meinung. Sie bestimmen hinterher die Wassertemperatur in der Breite. Und das mit der Hitze darf man auch ein bisschen deutlich nehmen. Es geht manchmal schon recht hitzig zu. Aber es ist eben ein vergleichsweise kleinerer Teil der Bevölkerung, der auf diese Weise nachher einen ziemlich großen Einfluss darauf hat, wie die Menschen in Deutschland denken. Und das wiederum hat dann natürlich auch Einfluss auf die Politik.
Frank: Absolut. Und natürlich haben wir direkt eine Anfrage vorbereitet. Die würde ich aber noch mal ganz gern verknüpfen mit einer spontanen Frage. Social Media und Reichweite gehen natürlich miteinander einher. Und wir hatten ja früher so die klassische Aufteilung, Journalisten als Gatekeeper, die haben so die Mengelage abgewogen und konnten dann entscheiden, was in das reichweitestarke Blatt kommt. Und heutzutage kann jeder mit einem gut gemachten Social Media Account eine größere Reichweite erzielen als unsere klassischen Tageszeitungen. Diese Frage würde ich noch einmal ganz gerne vorab stellen, weil es passt jetzt gerade so schön.
Ruprecht Polenz: Ja, also Sie beschreiben das jetzt ein bisschen aus dieser Rolle. Jetzt endlich bin ich sozusagen frei und niemand bevormundet mich bei dem, was ich nun zur Kenntnis nehme, lese, glaube. Im Grunde ist das aber ein großes Problem. Die Rolle, die Qualitätsjournalismus leistet und uns abnimmt, ist ja darüber nachzudenken, was ist wichtig, was ist richtig, was stimmt. Also Quellenrecherche. Und das Ganze auch ein Stück weit einzuordnen. Also jetzt nicht nur bestimmte Nachrichten, sondern dann eben auch durch Kommentarangebote. Zu sagen, man könnte das so einordnen und so. Deshalb ist es immer wichtig, weil Kommentare ja auch eine subjektive Meinung wiedergeben, dass man sich da etwas breiter aufstellt beim Konsumieren von Medien. Jetzt ist es so, dass wir eine explodierende Fülle von Informationen haben. Niemand sagt uns, was davon ist wichtig. Niemand sagt uns, was davon stimmt. Und wir geistern da jetzt durchs Internet und pflücken uns irgendwie raus, was wir dann glauben wollen. Und deshalb plädiere ich sehr dafür, dass man im Schulunterricht eine verkürzte Volontärsausbildung macht. Volontäre lernen genau das, was ist wichtig, stimmen die Quellen und wie fasst man es so zusammen, dass die Information dann auch entsprechend ankommt. Und diese Fähigkeiten, manche nennen das dann Medienkompetenz, die braucht man jetzt viel stärker, weil natürlich der Geist nicht mehr in die Flasche kommt. Also wir werden nicht mehr in die Situation kommen wie vor der Digitalisierung. Aber wir können schon daran arbeiten, dass die Menschen, wenn sie jetzt im Netz sich umschauen, nun nicht irgendein obskures Video gleichsetzen mit einer Information, die auf dem Account der Tagesschau ins Netz eingestellt wird.
Frank: Ganz genau. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Medienbildung, verkürztes Volontariat an den Schulen, das ist eine ganz spannende Idee, die wir gerne mal aufgreifen wollen und auch mal hier zur Diskussion stellen möchten. Ich finde das genau richtig.
Ruprecht Polenz: Wenn ich da noch einen kleinen Hinweis geben darf. Zeitungen bemühen sich ja auch um junge Leser, machen tolle Projekte. Und vielleicht wäre es auch möglich, Zeitungen bei Ihnen dafür zu interessieren. Mal mit so einer Kurzfassung. Was lernt eigentlich jemand bei uns, damit er als Journalist diese verantwortliche Aufgabe des Vorsortierens wahrnehmen kann. Und auf diese Weise das auch mal als externer Schulbesuch in die Schulen zu kommunizieren. Ich könnte mir vorstellen, dass Zeitungen da durchaus zu bereit sind, um dann überhaupt das Problembewusstsein in diese Richtung ein bisschen voranzubringen.
Frank: Ja, finde ich super. Das ist eine super Anregung. Jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. In Ihrem Buch »Tu was« sprechen Sie von der Notwendigkeit, die Demokratie zu verteidigen. Welche konkreten Möglichkeiten sehen Sie für die Bürgerinnen und Bürger, sich im Alltag für die Demokratie einzusetzen?
Ruprecht Polenz: Ja, da kommen Sie jetzt sozusagen gleich an die fünfte Schlussfolgerung. Ich habe es in meinem Buch etwas anders angefangen. Ich möchte, dass man im Ergebnis sagt, ja, ich muss was tun. Deshalb der Titel. Aber damit man dazu motiviert ist, muss man erst mal, glaube ich, sich klarmachen, dass das, was man für selbstverständlich hält, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Man wird nicht als Demokrat geboren, sage ich, sondern wenn man Glück hat, wird man in eine der 21 Demokratien geboren, die es auf der Welt überhaupt nur gibt. Nach einem Index der britischen Zeitschrift »Economist«.
Dann erkläre ich ein paar der großen Vorteile, die Demokratien haben. Und im Zweiten dann, wie Demokratie funktioniert. Denn nur wenn man versteht, also mir geht es jetzt nicht darum, wie kommt ein Gesetz zustande oder so, sondern dass Demokratie beispielsweise eine Vertrauensbasis braucht, dass die Wahrnehmung demokratischer Rechte in einer Weise geschehen muss, dass man sie nicht überdehnt. Das ist ein Punkt, der jetzt in den USA auch eine große Rolle spielt in der Diskussion, warum funktionieren unsere verfassungsmäßigen Institutionen nicht so richtig. Sie funktionieren deshalb nicht mehr, weil die Rechte sozusagen überdreht wahrgenommen werden. Letzter Satz zu dem Punkt, was Bückenförde gesagt hat, unsere Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selber nicht erschaffen kann. Und damit meinte er das soziale Kapital in einer Gesellschaft, das gegenseitige Vertrauen, auch das Engagement. Das versuche ich zu erklären, warum das wichtig ist, weil ich komme dann im dritten Abschnitt zu der Frage, wodurch ist das denn bedroht? Und wenn ich sage, Demokratie verteidigen, dann haben manche vielleicht die Vorstellung, na ja, es steht ja jetzt noch kein Panzer vor dem Reichstag und solange das nicht so weit ist, sind wir auch nicht in Gefahr. Die Gefahr besteht eben darin, dass systematisch das Vertrauen in das Funktionieren der Demokratie erschüttert wird. Wir könnten da noch, wenn Sie mögen, drüber reden, mit welchen Mechanismen das passiert. Und dass dadurch der Weg frei gemacht werden soll für ganz andere autoritäre Vorstellungen. Also nichts funktioniert mehr. Jetzt muss man endlich einer auf den Tisch hauen und muss sagen, wo es lang geht und dann geht es weiter. Das ist jetzt verkürzt gesagt die Botschaft von Orban gewesen. Und ich versuche auch zu erklären, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, da sollen sich doch die Politikerinnen und Politiker drum kümmern. Denn das reicht nicht. Also eine Demokratie muss von der Gesellschaft getragen sein. Sie lebt vom gesellschaftlichen Engagement und das betrifft jeden und jede von uns. Und da gebe ich dann eben, und jetzt bin ich endlich bei Ihrer Frage, da gebe ich dann eben zwölf Tipps, was man machen kann. Dinge, die man sofort machen kann. Manche sind ein bisschen schwieriger, aber alles ist eigentlich so. Das hoffe ich jedenfalls so im Bereich dessen liegt, was man sich vorstellen kann, wenn man das Buch liest. Ich fange mal mit dem einen Punkt an, mit dem ich auch im Buch angefangen habe. Zeigen Sie Zivilcourage. Warum ist das wichtig? Stellen Sie sich vor, Mittagessen in der Betriebskantine. Zehn Leute sitzen um den Tisch. Irgendwann kommt das Gespräch auf Erfurt oder auf Solingen, wo jetzt gerade irgendwo was passiert ist. Und da macht jemand eine ausländerfeindliche Bemerkung. Jetzt haben Sie einmal die Möglichkeit, Sie überhören das. Oder Sie fangen mit Ihrem Nachbarn ein Gespräch darüber an, warum der HSV diesmal wieder nicht aufsteigt. Oder Sie widersprechen. Und wenn Sie widersprechen und Zivilcourage zeigen, werden Sie merken, dass das am Tisch auch andere ermutigt, auch zu widersprechen. Denn Zivilcourage ist ansteckend. Wenn Sie nicht widersprechen, dann passiert, würde ich für wetten, zwei, drei Tage später dasselbe. Und der legt noch eine Schippe drauf. Weil er das Schweigen als Zustimmung abspeichert und sagt, da kann ich weiter überzeugen, dass das mit den Ausländern in Deutschland alles nicht so richtig ist. Das ist jetzt ein Beispiel. Und es gibt ja ganz viele, die eben auch dann gleich einfallen. Also zeigen Sie Zivilcourage, ist etwas, auf das unsere Demokratie bei möglichst vielen Menschen angewiesen ist.
Und dann gibt es halt noch andere Vorschläge. Vielleicht noch der am Ende, den ich am Ende gemacht habe, weil der ist vielleicht auch so ein bisschen in diesem Kontext ungewöhnlich. Ich sage, bedanken Sie sich. Und wenn man das so liest, denkt man, was hat das mit Politik zu tun? Naja, es ist so, ich empfehle zum Beispiel, sich mal bei Polizeibeamten zu bedanken, die man irgendwo trifft, dass sie für die Sicherheit sorgen. Oder beim Kassierer an der Kasse, dass er da auch immer freundlich sitzt. Und beim Paketboten etc. Das Schöne ist, wenn man dieser Empfehlung folgt, man wird sofort selber belohnt. Weil derjenige oder diejenige, bei dem man sich bedankt, der lächelt zurück, um das mal so zu sagen. Und jetzt kommt der politische Punkt. Es gibt kaum etwas, was gesellschaftlichen Zusammenhalt so sehr stärkt, wie sich zu bedanken. Und da bin ich jetzt wieder bei diesem politischen Punkt, die Voraussetzung unserer Demokratie, die sie nicht selber schaffen kann. Dadurch entsteht, wenn wir uns jetzt alle viel mehr für das bedanken würden, für das man sich in der Tat auch bedanken könnte, und nicht nach dem Motto, nichts gesagt ist gelobt genug. Das ist so ein beschwerlicher Spruch. Ich weiß nicht, ob es den bei Ihnen etwas weiter im Norden auch gibt. Dann bekomme ich eine positive Stimmung, eine eher zuversichtliche Stimmung. Und jetzt springe ich zur AfD und den Feinden unserer Demokratie, die genau das nicht wollen. Sie wollen ja die Gesellschaft spalten, sie wollen eine schlechte Stimmung, sie wollen Wut, Angst, Ärger. Die würden nie von AfD-Politikern hören, bedankt euch. Sondern sie hören von denen immer, was alles nicht läuft, weshalb man sauer sein muss auf die, mit denen man es zu tun hat. Und deshalb hat das eine politische Dimension. Und das Schöne bei dieser Empfehlung ist, jeder kann es ab sofort machen.
Dani: Das stimmt. Total. Das sprechen Sie mir auch aus dem Herzen. Ich bin auch ein Mensch, der sehr dankbar ist, dass ich hier wohne, dass ich hier leben darf, dass ich so leben darf, wie ich lebe. Und gleichzeitig bin ich auch sehr dankbar für das Miteinander und die Menschen hier oben, speziell wo ich jetzt hier wohne. Das ist sehr schön. Da sagen die Leute nicht nur Moin, sie lächeln auch. Und das von jung bis alt. Es ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich habe in vielen Orten in Deutschland gelebt. Und wo ich auch sage, genau das dürfen wir uns, dieses Miteinander, diesen Zusammenhalt, den dürfen wir uns nicht nehmen lassen. Von daher auch einfach mal Danke zu sagen. Genau. Und jetzt haben wir die einen Menschen, die das vielleicht auch erkannt haben, die sagen, hey, wir brauchen ein Miteinander. Genau jetzt ist die Zeit, wir müssen zusammenhalten. Dann haben wir die Gruppe, die hetzt, die versucht, diese Gesellschaft zu spalten. Und was jetzt ja auch nicht neu ist, aber natürlich immer mehr auch verstärkt wird, ist ja die Politikverdrossenheit. Wo man dann einfach sagt, hey, lasst mich doch mit dem ganzen Kram in Ruhe. Hier kein Streit, da muss ich es ja auch nicht. Und schalten einfach ab. Wie könnte man Ihrer Meinung nach, vor allem ja auch junge Menschen, ist ja auch wichtig, die jungen Menschen motivieren, dass sie sich eben auch politisch engagieren.
Ruprecht Polenz: Also gucken wir mal auf die jüngeren Menschen, die noch in die Schule gehen beispielsweise. Ich vergleiche das mal mit einem Schwimm-Demokratie. Man kann wahrscheinlich auch übers Schwimmen, irgendwie Bücher lesen oder kann sich da was im Klassenzimmer erzählen lassen. Aber wenn man es lernen will, muss man ins Wasser springen. Und so ähnlich ist das mit der Demokratie auch. Ich hatte ja gesagt, man wird nicht als Demokrat geboren. Man muss es lernen. Und das gehört dann eben auch zum Lernen in der Schule. Aber eben jetzt nicht nur theoretisch, wie kommt ein Gesetz zustande, gibt es Einspruchsgesetz und Zustimmungsgesetz, und da muss man das irgendwie lernen. Man macht es, weil man abgefragt wird und eine Note bekommt. Das ist nicht sozusagen demokratische Bildung in dem Sinn, der mir vorschwebt, sondern machen. Es gibt von Marina Weisband, die auch in Münster lebt, frühere Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei, jetzt ist sie bei den Grünen, die hat ein Projekt, wo sie mit digitalen Plattformen, Schulen hilft, innerschulische Prozesse im Rahmen der Gesetze, das ist eine Möglichkeit. Und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Auch mal zu fragen bei Ihnen im Kreis, welche Schule ist da vielleicht dabei. In Deutschland sind einige dabei, aber ganz viele noch nicht. Wo man mit Schülerinnen und Schülern den Schulalltag so diskutiert, dass sie Selbstwirksamkeit erfahren, wie dieser Alltag abläuft. In dem Moment, wo ich das in meiner Schulzeit gelernt habe, ich kann durch meine Beteiligung an diesen Prozessen etwas machen, was das Alltagsleben in dieser Situation beeinflusst.
Oder ich kann nachvollziehen, weil ich an den Prozessen beteiligt war, warum meine Ideen nicht zum Zuge gekommen sind. Das ist auch ganz wichtig. Jeder denkt, warum sind die so doof und machen es nicht, wie ich es denke. Das Problem ist, dass viele andere es genauso denken. Man kann aber nicht alles gleichzeitig machen, wenn es sich widerspricht. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt.
Und dann bin ich eben mit diesem Stichwort Selbstwirksamkeit auch in der unmittelbaren Umgebung. Eltern zum Beispiel können Selbstwirksamkeit erfahren, wenn sie sich in der Elternpflegschaft oder in der Elternarbeit in der Kita engagieren. Man kann in der Nachbarschaft über Initiativen etwas machen. Ich spreche darüber auch ein bisschen in meinem Buch. Man kann die Politik nicht beeinflussen. Man guckt nach meinem Eindruck auf die Nachrichten der Tagesschau. Was in den USA und Berlin passiert, können wir nicht beeinflussen. Aber in der kommunalen Umgebung sieht es schon ganz anders aus. Demokratie wächst auch von unten nach oben. Wir haben in Deutschland das System einer relativ starken kommunalen Selbstverwaltung. In den Städten und Gemeinden fallen wichtige Entscheidungen. Je nachdem, wie stark man sich engagieren möchte, kann man auch mal überlegen, sich für eine begrenzte Zeit auch um ein Mandat im Gemeinderat zu bewerben.
Dann bin ich auch noch mal beim Bedanken der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, die da jede Woche 3-4 Stunden von ihrer Freizeit hergeben, damit es der Gemeinde irgendwie besser geht. Selbst wenn man mit den Ergebnissen nicht immer einverstanden ist, was auch wieder normal ist. Aber dass ihr das macht, finde ich eigentlich gut. Nicht nur die Feuerwehr, sondern auch die Kommunalpolitiker.
Dani: Ja, sehe ich ganz genau so.
Frank: Absolut.
Dani: Das wissen vielleicht auch nicht immer alle, was alles auch dahintersteckt. Und auch, dass die natürlich kämpfen. Manchmal kriegt man was in der Presse mit. Manchmal wird darüber berichtet. Manchmal einseitig. Manchmal gibt es solche, die lauter sind. Und hier kann ich auch nur einladen, auch einfach mal mit den Kommunalpolitikern ins Gespräch zu gehen. Oder auch mal einfach hinzugehen. Es gibt ja auch viele öffentliche Veranstaltungen, wo man einfach mal hingehen kann. Dass man ein Gefühl dafür bekommt, was dort eigentlich ist. Und dann gerne mit dem Bewusstsein, dass die Menschen das ehrenamtlich machen und sich für ihre Stadt einsetzen.
Ruprecht Polenz: Das ist, glaube ich, der Punkt, dass man versteht, dass Demokratie jetzt nicht etwas ist, was einem geboten wird. Wo man auf der Tribüne sitzt und Beifall klatscht und Daumen hoch und Daumen runter bei den Wahlen oder so. Sondern dass man eben auf dem Spielfeld sein sollte, selbst auch, damit ein vernünftiges Ergebnis dabei rauskommt. Also es ist kein Zuschauersport.
Frank: Das stimmt. Und zu Wahlen ist es ein Vollkontaktsport.
Ruprecht Polenz: Ja, muss es nicht sein. Und das ist jetzt auch so eine Sache. Klar, wir haben unterschiedliche Interessen. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Darüber muss man reden. Das gibt auch Konflikte. Aber wir haben jetzt schon, denke ich, ein Instrumentarium, diese Konflikte zivil auszutragen. Und wir können natürlich alle auch immer noch ein bisschen besser werden, was wertschätzende Kommunikation angeht.
Frank: Das stimmt. Mit Ihrer jahrelangen Erfahrung in der Politik, wie schätzen Sie denn so die Rolle von lokalen Initiativen und gemeinnützigen Vereinen für eine lebendige Demokratie ein? Sind das Konkurrenten für die klassischen Parteien? Oder wie schätzt du das ein? Also das kann ja auch ein Einstieg für Menschen in die Politik sein.
Ruprecht Polenz: Also ich begrüße das sehr. Das ist auch eine der Möglichkeiten, sich zu engagieren, die ich empfehlen würde. Vor allen Dingen, wenn man sich noch nicht so genau parteipolitisch festlegen möchte. Gar keine Frage. Und vielleicht kann ich an der Stelle erzählen, wie das bei mir war. Also ich kam hier zum Studium und habe mich dann eben im Ring Christlich Demokratischer Studenten engagiert.
Aber ich war noch in keiner Partei. Und ich hätte mir auch ganz gut vorstellen können, mich bei so einer Organisation zu engagieren. Für mich kam zum Beispiel Amnesty International in Frage. Oder vielleicht auch bei einer anderen Nichtregierungsorganisation. Wenn man sich dann anschaut, wie sie ihre Arbeit machen, und das ist wichtig und notwendig, dann besteht das ja im Wesentlichen darin, dass sie Forderungen an die Politik richten. Da lag für mich der Gedanke nahe, dass es vielleicht noch schlauer ist, sich dort zu engagieren, wo über diese Forderungen entschieden wird. Und damit war ich dann bei der Überlegung, in eine politische Partei einzutreten.
Dann kommt aber sofort die Schwierigkeit: Welche soll es denn sein? Ich bin doch eigentlich mit keiner so zu 100% einverstanden. Und da würde ich jetzt sagen, das wird sich auch nie ändern. Man findet die Gruppe nicht, die alles ganz genauso macht, wie man es selbst für richtig hält. Deshalb ist auch bei der Mitgliedschaft in einer politischen Partei, finde ich, eine Quote von 60 bis 70 Prozent Übereinstimmung völlig ausreichend. Die Parteien erwarten im Grunde auch gar nicht mehr. Vorausgesetzt ist allerdings, dass man Mehrheitsentscheidungen dann loyal mitträgt und dass man in der Grundüberzeugung übereinstimmt. Aber bei den einzelnen Maßnahmen kann man ruhig anderer Meinung sein.
Mir ist an dieser Stelle auch noch einmal wichtig, die Einsicht zu vermitteln oder den Punkt anzusprechen, dass eine repräsentative Demokratie ohne politische Parteien nicht denkbar ist. Das heißt also, dieser Spruch, Politik sei ein schmutziges Geschäft und Parteipolitik die Steigerung davon, ist in sich schon ein Vorwurf, wenn es heißt: „Du machst das ja nur parteipolitisch.“ Da muss man gegenhalten, denn so ist unsere Demokratie angelegt. Jeder vertritt einen Teil, und hinterher muss man sehen, dass ein Ganzes daraus wird, durch die Entscheidungen, die die Demokratie vorgibt, letztlich durch Mehrheitsentscheidungen.
Deshalb sind die Vorfeldorganisationen alle super. Ich sage ja auch, das ganze ehrenamtliche Engagement, darauf können wir stolz sein. Über 30 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Das alles stabilisiert das Fundament der Demokratie.
Dani: Ja, absolut, finde ich auch. Wir haben jetzt in diesen Zeiten, wir wollen ja auch ein bisschen über das Thema soziale Medien sprechen und die Beeinflussung der Menschen, wenn ich das mal so sagen darf. Da gibt es ja auch den schönen Begriff „Fake News“. Darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Sachen zu prüfen. Wie können wir die Widerstandsfähigkeit der Demokratie stärken und Menschen dazu bringen, sich kritisch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und nicht einfach nur den populistischen Floskeln zu folgen?
Ruprecht Polenz: Ja, vielleicht hilft es, wenn man sich die Bedeutung klar macht, dass man auf die Frage „Wem glaube ich?“ die richtige Antwort gibt. Es ist ja so, dass unser Weltbild, was wir für richtig halten, wie wir uns orientieren, was wir glauben, was gerade in der Welt passiert, ganz wenig, vielleicht nur zu 3 bis 5 Prozent, auf persönlichen Erfahrungen basiert. 95 Prozent sind medienvermittelt. Und jetzt haben wir seit etlichen Jahren von rechtsextremer Seite diesen Vorwurf der „Lügenpresse“. Dieser Vorwurf unterstellt allen Medien, also den klassischen, wie dem Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, dem Spiegel, der Zeit, der Taz, der FAZ, dass sie systematisch lügen würden.
Wenn ich jetzt mein Vertrauen dadurch untergraben lasse und sage, da stimmt wohl doch alles gar nicht, was da gesagt wird, und immerhin glaubt das inzwischen jeder Fünfte in Deutschland, dann bin ich orientierungslos. Mir fehlen ja jetzt diese 95 Prozent, die bisher mein Weltbild mitgeprägt haben, was ich für richtig halte. Also, ich habe da eben gelesen, in Indien entgleist ein Zug, das kam in der Tagesschau, also wird es passiert sein. So, ich bin orientierungslos, und das stellt man sich am besten so vor, dass man dann Nebel im Kopf hat.
Und ich weiß, ich glaube, in Norddeutschland ist es gelegentlich nebelig, aber stellen Sie sich noch dichteren Nebel vor. Das heißt, Sie können sich eigentlich gar nicht mehr orientieren, und es ist schwerer, sich bei Nebel zu orientieren, als bei Nacht. Was macht man in so einer Situation? Man kann ja nicht einfach stehen bleiben, man muss irgendwie wieder nach Hause kommen oder unter Menschen. Also spitzt man die Ohren, ob man etwas hört, und reißt die Augen ganz weit auf, ob man irgendwo etwas sehen kann. Was sieht man als Erstes? Das grellste Licht. Und was hört man als Erstes? Den lautesten Schreihals. Und wo landet man dann? Bei der AfD und bei Trump. Dieses grelle Licht ist das Reduzieren komplizierter Probleme auf einfaches Schwarz-Weiß, Freund-Feind-Denken.
Gleichzeitig wird die Lautstärke der Polarisierung verstärkt. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Kampagne „Lügenpresse“, der daraus resultierenden Orientierungslosigkeit und dem Hinwenden zu einfachen, scheinbar schlüssigen Lösungen. Wenn man sich das erst einmal klar gemacht hat, denke ich, verwendet man mehr Aufmerksamkeit darauf, die Frage zu stellen: Wem kann ich vertrauen und warum? Dann ist man, denke ich, schon dabei, sich zum Beispiel einmal wirklich in Ruhe anzuschauen, wie eigentlich die Konstruktion des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist.
Da stellt man fest, dass dieser frei von Kapitalinteressen ist, staatsfern organisiert ist und die Journalisten ordentlich finanziert werden. Das heißt, man kann eigentlich darauf vertrauen, dass dort Qualitätsjournalismus herauskommt. Das bedeutet nicht, dass dort nicht auch mal Fehler passieren oder dass man sich über das Programm an der einen oder anderen Stelle ärgert. Aber ich glaube, die meisten Menschen haben immer noch, wie Umfragen zeigen, das höchste Vertrauen in die Nachrichtensendungen von ARD und ZDF. Ich denke, das liegt genau aus diesem Grund. Dieses Vertrauen sollte man sich nicht durch solche Kampagnen nehmen lassen. Das Gleiche gilt auch für den Printqualitätsjournalismus und ähnliche Medien.
Trotz des Überangebots und der Menschen, die sich jetzt nur noch auf TikTok informieren – und ich habe heute gerade einen sehr spannenden Artikel in der FAZ von einem Dschihadismus-Forscher gelesen, der sich mit islamistischem Extremismus beschäftigt. Der erklärt, dass die Radikalisierung überwiegend in Deutschland stattfindet, dass sie über salafistische Gemeinden erfolgt und eben über TikTok. Sie nutzen TikTok als Rekrutierungsinstrument für radikalisierte Muslime. Da liegen die Gefahren.
Als Eltern muss man irgendwie mit den Kindern darüber sprechen, man muss versuchen, dass die Kinder einem erzählen, was sie im Netz alles erleben. Das ist eine Vertrauensfrage, die nicht erst beginnt, wenn die Kinder alt genug sind, um ein Handy zu bekommen, sondern das geht von klein auf los. Wenn dann Vertrauen da ist, reden die Kinder auch über solche Dinge.
Dani: Ich möchte eine Frage dazwischenstellen. Sie haben gerade TikTok erwähnt, und das ist natürlich auch etwas, das aktuell sehr präsent ist. Nächstes Jahr ist Wahljahr. Man weiß, welche Parteien dort sehr aktiv sind und welche vielleicht noch mehr machen sollten. Man sieht auch, welche Menschen Ahnung von den Medien haben und wie man sie nutzt. Facebook funktioniert anders als Instagram, und das wiederum anders als TikTok, auch in Bezug auf die Sprache, die Schnelligkeit und so weiter.
Glauben Sie, dass es sinnvoll ist, sich als Politiker oder mit seinen Themen dort zu platzieren, um möglicherweise entgegenzuwirken? Es gibt Leute, die sagen, das bringt doch gar nichts, weil die Leute dort schon voreingenommen sind. Wie schätzen Sie das Thema TikTok ein? Nicht für Sie persönlich, sondern generell für die nachfolgende Generation, die sich engagiert und sagt: „Hey, wir kämpfen für die Demokratie.“
Ruprecht Polenz: Also, ich glaube, man kann generell nachweisen, dass die Algorithmen, nach denen Social Media funktionieren, für Demokratien problematisch, vorsichtig formuliert, auf den Punkt gebracht sogar zersetzend sein können. Kurz erklärt: Alle Plattformen leben von Werbung, und die Algorithmen zielen zuerst darauf ab, dass die Menschen möglichst lange auf der Plattform bleiben, damit sie möglichst viel Werbung sehen können. Wann bleibt man lange? Wenn man Gleichgesinnte trifft, die die eigene Ansicht bestätigen, und wenn man sich emotional erregen kann.
Dann möchte man auch immer mehr, und deshalb kommt es zu dieser Bildung von Filterblasen. Viele denken, alle lesen das Gleiche, was sie selbst lesen, wenn sie ihre Timeline öffnen. Aber nein, keine Timeline sieht so aus wie die andere. Sie wird individuell zusammengestellt, nach dem Prinzip: Wer das gelesen hat, möchte wahrscheinlich auch das lesen – ähnlich wie bei Netflix oder Amazon. So funktionieren diese Algorithmen auch.
Dann werden die Inhalte in den Vordergrund gerückt, die emotional aufwühlen. Empörung, Ärger und Wut sind dabei viel leichter auslösbare Emotionen als Mitgefühl oder Hilfsbereitschaft. Deshalb werden solche Posts in ihrer Reichweite begünstigt. Dazu kommt, dass Elon Musk gezielt die Schleusen für rechtsextreme Portale geöffnet hat, wodurch deren Reichweite auf X (ehemals Twitter) erhöht wurde. Das macht das Klima auf dieser Plattform noch schwieriger.
Trotzdem, auch wenn es für vernünftige Diskussionen oft wie Bergauf-Fahren oder, um im norddeutschen Bild zu bleiben, wie Fahrradfahren mit Gegenwind ist, sind diese Plattformen da und beeinflussen die öffentliche Meinung, wie ich es zuvor beschrieben habe. Es bleibt also nichts anderes übrig, als sich selbst dort zu engagieren – auch auf TikTok.
Jetzt zu der Frage, warum ich persönlich nicht auf TikTok bin: Erstens, ich bin nicht besonders gut darin, solche kurzen Videogeschichten zu machen. TikTok lebt von solchen Bildbotschaften. Zweitens glaube ich auch, dass ich dort nicht authentisch wirken würde, weil die Altersgruppe, die dort hauptsächlich aktiv ist, doch sehr viel jünger ist. Und in den sozialen Medien ist glaubwürdige Kommunikation entscheidend. Die Form und die Art, wie man Inhalte präsentiert, müssen zu dem passen, wer man ist und welche Botschaft man hat. Das könnte ich auf TikTok nicht, deshalb bin ich auf anderen Plattformen. Ich überlege noch, ob ich etwas mit Instagram machen soll, habe mich aber noch nicht entschieden. Irgendwo gibt es auch Grenzen, und meine Familie möchte mich auch mal ohne Bildschirm sehen.
Dani: Das verstehe ich gut.
Frank: Vielen Dank für diese wertvollen Gedanken zu TikTok, Instagram und den anderen sozialen Medien. Kommen wir zurück zu einer eher grundsätzlichen Frage.
Sie vergleichen die Demokratie mit einem Lottogewinn, der schnell verspielt werden kann. Welche Gefahren sehen Sie aktuell für unsere Demokratie, und wie können wir ihnen begegnen, außerhalb von Social-Media-Kanälen?
Ruprecht Polenz: Ja, ich spreche oft von Kipppunkten. Bei der Klimadebatte haben wir gelernt, dass es Kipppunkte gibt – wie den Golfstrom, der seine Richtung ändern könnte, oder das Auftauen der Permafrostböden. Es gibt etwa neun globale Kipppunkte, und wenn einer oder zwei davon erreicht werden, sind die Folgen oft irreversibel. Ich finde das Bild vom Kippen sehr anschaulich. Normalerweise sagen wir Kindern, sie sollen nicht kippen, wenn sie am Tisch sitzen. Warum? Wenn sie das Gleichgewicht verlieren, gibt es von der Schräge bis zum Aufprall auf dem Boden keinen Weg mehr zurück, und der Aufprall ist hart.
Das gilt auch für die Demokratie. Wenn die Menschen das Vertrauen verlieren, kippt sie. Um das zu verdeutlichen, möchte ich ein anderes Beispiel verwenden: Demokratie ist eine vorgestellte Ordnung. Sie funktioniert, solange wir an sie glauben – ähnlich wie das Vertrauen in Geld. Wenn Sie einkaufen gehen, sind Sie sicher, dass Sie für die Scheine in Ihrem Portemonnaie etwas bekommen. Vor 100 Jahren war das anders. Damals hätten Sie eine Schubkarre gebraucht, um genug Reichsmarknoten für ein Brot zu bekommen, weil das Vertrauen in die Währung verloren gegangen war. Es war „gekippt“, und es bedurfte nachher erheblicher Reformen, um das Vertrauen wiederherzustellen und den Handel mit Zigaretten, Alkohol und anderen Tauschmitteln zu verdrängen. So ist es auch mit der Demokratie.
Und deshalb ist die Achillesferse der Demokratie, wenn das Vertrauen in ihr Funktionieren erschüttert wird. Wenn die Menschen nicht mehr daran glauben. Es gibt einige besorgniserregende Indikatoren, die sich in Meinungsumfragen widerspiegeln. Ich habe bereits erwähnt, dass jeder Fünfte glaubt, die Medien würden uns systematisch belügen. In Ostdeutschland ist dieser Anteil sogar noch höher. Viele Menschen dort sind der Meinung, dass wir gar nicht von unserer Regierung regiert werden, sondern von irgendwelchen finsteren Mächten.
Und wenn man die Menschen fragt, welche Partei die Probleme am besten lösen kann, sagen 60 %: Keine. Das ist ein massives Misstrauen oder zumindest eine stark erschütterte Zuversicht. In dieser Situation agieren Kräfte wie die AfD und in Teilen auch die BSW, die dieses Misstrauen weiter schüren. Das sind die Feinde von innen.
Von außen denken wir an Putin, der immer das Ziel hatte, die EU zu spalten und demokratische Gesellschaften zu destabilisieren, weil eine Diktatur durch Demokratien systemisch herausgefordert wird. In einer Diktatur können all diese Freiheitsrechte über Nacht verschwinden. Putin arbeitet auch mit bestimmten Organisationen zusammen, um diese Ziele zu erreichen. Es ist kein Zufall, dass Sahra Wagenknecht in ihren Aussagen teilweise die gleichen Worte verwendet, wie sie im russischen Abendprogramm zu hören sind. Putin hat auch den vorletzten Wahlkampf von Le Pen in Frankreich mit einem großen Kredit finanziert.
Feinde kommen also von innen und von außen. Aber die Demokratie wird auch gefährdet, wenn sie ihre Aufgaben nicht erfüllt, wenn Probleme ungelöst bleiben. Politische Parteien, ebenso wie wir alle, haben die Aufgabe, diese Probleme anzugehen und zu lösen. John McCain sagte einmal in einer Rede: „We get nothing done.“ Das Gefühl, dass wir nicht mehr genug geregelt bekommen, ist weit verbreitet, und das nicht ganz unberechtigt.
Dani: Wenn ich über Probleme spreche, denke ich oft daran, dass Probleme, die von plumpen Parolen begleitet werden, wie ich bereits erwähnte, die Menschen ansprechen, weil sie sich gehört und verstanden fühlen. Diese Parolen bieten zwar eine Bestätigung, dass es ein Problem gibt, aber sie bieten keine Lösungen. Trotzdem schaffen sie ein Gefühl von „Commitment“.
Ich sage auch oft, im Wort „Populist“ steckt das Wort „List“. Populisten wissen genau, was sie tun. Deshalb ist es wichtig, diese plumpen Parolen zu entlarven. Als erfahrener Politiker und aktiver Kommunikator in den sozialen Medien empfehle ich den Menschen, kritisch mit diesen populistischen Botschaften umzugehen.
Ruprecht Polenz: Die Menschen suchen Orientierung. Schwarz-Weiß-Denken bietet ihnen eine solche Orientierung. Das „Wir gegen die“ ist auch ein einfaches Orientierungsangebot. Das Vereinfachen komplexer Probleme auf Ja-Nein-Antworten bietet ebenfalls Orientierung.
Und damit habe ich bereits drei wesentliche Elemente einer populistischen Kommunikationsstrategie benannt. Wenn man sich anschaut, was die Menschen belastet, dann ist es oft die Unübersichtlichkeit, die sie daran hindert, sich zurechtzufinden. Wie Sie sagen, es ist komplizierter geworden. Durch neue Technologien wird die Veränderungsgeschwindigkeit immer höher, und viele Menschen kommen kaum noch hinterher.
Ein weiterer Faktor ist die Art und Weise, wie Verantwortliche kommunizieren. Oft wird in einer Weise gesprochen, die es den Menschen schwer macht, nachzuvollziehen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden oder warum andere Dinge unterlassen werden. Politische Diskussionen, wie sie in den Medien dargestellt werden, bestehen oft aus einzelnen Puzzleteilen, die auf den Tisch gelegt werden, ohne dass das Gesamtbild erkennbar ist. Man kommuniziert über ein Detail, zum Beispiel eine Stahlstrebe, ohne zu erklären, dass sie Teil eines Eiffelturms ist. Die Menschen wissen also oft nicht, wohin die Reise geht oder wie weit man bereits gekommen ist.
Das ist eine wesentliche Führungsaufgabe der Politik. Angela Merkel war darin schon nicht besonders stark, aber Olaf Scholz ist in dieser Hinsicht ein absoluter Ausfall. Er erklärt kaum, wohin er will und warum. Eigentlich müsste jeder, der politische Inhalte vermittelt, zuerst das große Ganze erklären, also den Wald, bevor er auf die Bäume und schließlich die Blätter eingeht. Stattdessen beginnen wir oft mit den Blättern und wundern uns, dass die Menschen nicht verstehen, ob wir im Wald stehen oder ob da nur ein einzelner Baum auf einer Wiese steht.
Diese Einordnung ist entscheidend. Bei meinen Vorträgen versuche ich immer, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, die Nachrichten, die sie in den kommenden Wochen lesen werden, besser einzuordnen. Das ist eine wesentliche Aufgabe in der Kommunikation: den Menschen zu helfen, die vielen Alltagsinformationen richtig zu sortieren. Das kann man immer nur themenspezifisch machen.
Ich spreche zum Beispiel viel über den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, damit die Menschen dies im Kontext des Ostkonflikts einordnen können. Das erfordert auch eine gewisse Anstrengung. Man sollte nicht gleich mit einem spezifischen Thema wie einem Flüchtlingslager oder dem Gaza-Konflikt anfangen, sondern zunächst breiter erklären. Bildlich gesprochen: Man beginnt mit einem Weitwinkel und zoomt dann langsam heran, anstatt gleich mit der Lupe auf die Politik zu schauen. Das ist vielleicht das Bild, das es am besten beschreibt.
Frank: Wie können wir in der Gesellschaft dafür sorgen, dass vernünftige, rechtlich korrekte politische Ideen wieder mehr Gehör finden? Populismus breitet sich aus, auch befeuert durch Algorithmen und die sogenannte Bubble, in der man immer nur das hört, was man ohnehin hören möchte. Wie können wir es schaffen, dass wieder ein echter Diskurs stattfindet?
Ruprecht Polenz: Im Grunde läuft es immer wieder auf die Appelle der Aufklärung hinaus: die Menschen ermutigen, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen. Vieles kann schon erreicht werden, wenn man einfach einmal selbst überlegt, ob das, was einem erzählt wird, wirklich stimmen kann. Bei vielen Verschwörungsmythen, und ich sage bewusst nicht „Verschwörungstheorien“, weil das zu wissenschaftlich klingt, ist es oft so, dass behauptet wird, etwas werde von einer kleinen Gruppe im Geheimen gesteuert und wir seien alle davon betroffen. Jeder, der ein wenig nachdenkt, weiß eigentlich, dass, wenn mehr als drei Leute etwas wissen, es kaum noch geheim bleiben kann.
Kann ja jeder im privaten Kreis mal ausprobieren. Warum sollte das bei so brisanten Themen anders sein? Eine relativ einfache, aus der eigenen Lebenserfahrung stammende Überlegung würde einen mindestens zu einer erheblichen Skepsis führen, wenn man glaubt, dass große Geheimnisse von einer beträchtlichen Anzahl von Menschen komplett geheim gehalten werden könnten. Das ist ein wichtiger Punkt.
Es gibt viele solcher Dinge, bei denen, wenn man einen Moment länger nachdenkt, das erste Fragezeichen aufkommt. Ein gutes Gegengift gegen Populismus ist eine gesunde Skepsis. Und natürlich auch die Erkenntnis, dass es sehr selten den großen Wurf gibt, der alle Probleme löst. Das ist ja auch ein typisches Versprechen des Populismus: eine einfache Lösung für komplexe Probleme. Aber in der Realität gibt es immer Risiken und Nebenwirkungen, wie bei den Beipackzetteln von Medikamenten. Eigentlich müssten solche Beipackzettel auch in der Politik mitgeliefert werden.
Deshalb müssen Gesetze oft nachgebessert werden, weil man bestimmte Nebenwirkungen vorher nicht gesehen hat. Politik ist ein bisschen wie Fahrradfahren: Der Lenker darf nicht starr sein. Man muss ständig nachjustieren, was viele Menschen nicht verstehen. Sie sagen: „Ihr habt doch gerade das Gesetz beschlossen, warum wollt ihr es jetzt schon wieder ändern?“ Die Antwort ist, dass es eben notwendig ist, weil man einen Punkt übersehen hat. Es gilt also, Verständnis für diese Prozesse zu fördern.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Einsicht, dass wir irren können. Die Erkenntnis unserer eigenen Fehlbarkeit und der grundsätzlichen Fehlbarkeit der Menschen führt zu einer anderen Art der Kommunikation. Ich kann dann nur so mit anderen reden, dass ich anerkenne, dass sie vielleicht auch ein Stück weit Recht haben könnten und dass ich mich irren könnte. Das verändert sofort die Tonlage in einer Diskussion.
Frank: Das klingt alles sehr einfach, wenn Sie das so sagen. Ich hoffe, dass wir als Gesellschaft und mit den unterschiedlichen Akteuren die Mittel und Wege finden, um vernünftigen, wissenschaftlich fundierten Ideen, die aus dem demokratischen Diskurs entstehen, wieder mehr Raum zu geben. Es wäre wünschenswert, den Populisten gemeinsam das Wasser abzugraben. Das ist auch der Anlass für unseren Podcast. Wir wollen keine Falschinformationen mehr. Wir wollen den Menschen zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, auf Populismus und Falschinformationen zu reagieren.
Am Ende des Tages kommen wir immer wieder zu der Einsicht: Es geht um Bildung. Es geht darum, selbstständig nachzudenken, Wissen zu erlangen.
Ruprecht Polenz: Aber ich würde noch hinzufügen: Freiheit ist anstrengend. Das Versprechen lautet nicht, dass man gefüttert wird, um satt zu werden, und unterhalten wird, um lachen zu können. All das gibt es auch, aber man muss auch selbst etwas tun. Sich zu informieren ist anstrengender, als etwas vorgesetzt zu bekommen und dann blind zu folgen. Es gibt einen schönen Aphorismus von Stanisław Jerzy Lec, der sagt: „Schau dir zuerst den Taktstock des Dirigenten an, bevor du anfängst, im Chor zu singen.“
Diese Skepsis, sich die Dinge genau anzuschauen, ist entscheidend. Wie schaffen wir es, dass diese Haltung in der Gesellschaft weit verbreitet wird? Zunächst einmal, indem man sie selbst praktiziert. Man unterschätzt manchmal die Wirkung, die das haben kann. Und dann kommen die üblichen Instrumente ins Spiel, wie die Bildung in Schulen. Aber besonders wichtig ist auch, und ich weiß, dass Sie politisch engagiert sind, dass die politischen Parteien eine große Verantwortung für das Diskussionsklima im Land tragen.
Und ich glaube, dass die meisten Menschen es nicht besonders schätzen, wenn sich demokratische Parteien ungehemmt an die Gurgel gehen. Es gibt Meinungsumfragen, die zeigen, dass zwei Drittel der Menschen sagen, die Aufgabe der Opposition sei es, gut mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Das ist es, was die Menschen wollen. Ihnen ist es oft relativ egal, welche Partei ein Problem löst, solange es gelöst wird.
Natürlich müssen Konflikte artikuliert werden, damit man nachvollziehen kann, wie sie letztlich gelöst werden. Dieser Diskussionsprozess ist wichtig, denn die Menschen möchten verstehen, wie ein Vorschlag zum Gesetz wird. Besonders in der älteren Generation löst das Stichwort „Rente“ sofort Sorgen aus, obwohl es vielleicht um Themen geht, die vor allem die Jüngeren betreffen. Diese Diskussionen auszuhalten, ist anstrengender, als einfach ein Ergebnis präsentiert zu bekommen. Aber der Vorteil ist, dass man, wenn man die Diskussion verfolgt hat, versteht, wie das Ergebnis zustande gekommen ist. Das trägt zu einer höheren Legitimität des Ergebnisses bei, weil der Weg dorthin nachvollziehbar ist. In einer Demokratie geht es eben nicht anders, auch wenn es anstrengend ist.
Die Demokratie ist kein Käfig, auch kein goldener, und sie ist keine Vollkasko-Demokratie. Aber es lohnt sich, diese Anstrengungen auf sich zu nehmen.
Frank: Das war ein wirklich interessantes und aufschlussreiches Gespräch. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer konnten einiges lernen und einige Gedanken mitnehmen.
Dani: Am einfachsten kann man anfangen, indem man freundlich ist, dankbar, und auch mal nach rechts und links schaut, anstatt nur auf sich selbst. Das ist das Minimum, was jeder tun kann. Vielleicht hört jemand das gerade, während er oder sie draußen unterwegs ist, und kann das direkt ausprobieren, Vorbild sein und überlegen, was man selbst beitragen kann, damit wir weiterhin so frei leben dürfen. Es ist Arbeit, aber es wird einfacher, wenn wir alle gemeinsam daran arbeiten.
Es ist uns wichtig, das Miteinander zu fördern und uns nicht als Gesellschaft spalten zu lassen. Es geht darum, kritisch zu sein, ein gewisses Vertrauen in- und miteinander zu haben und nachfragen zu dürfen, ohne dass man schief angesehen wird. Das sollten wir immer tun, um Missverständnisse zu vermeiden und gemeinsam die Zukunft zu gestalten und für die Demokratie zu kämpfen.
Frank: Absolut. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir noch ein weiteres Thema für ein tolles Gespräch mit Herrn Polenz haben werden, nämlich die Außenpolitik und die Politik in Osteuropa, insbesondere den Ukraine-Krieg. Dazu laden wir euch und Sie jetzt schon herzlich ein. Das wird eine unserer nächsten Folgen sein. Bis dahin sagen wir Tschüss!