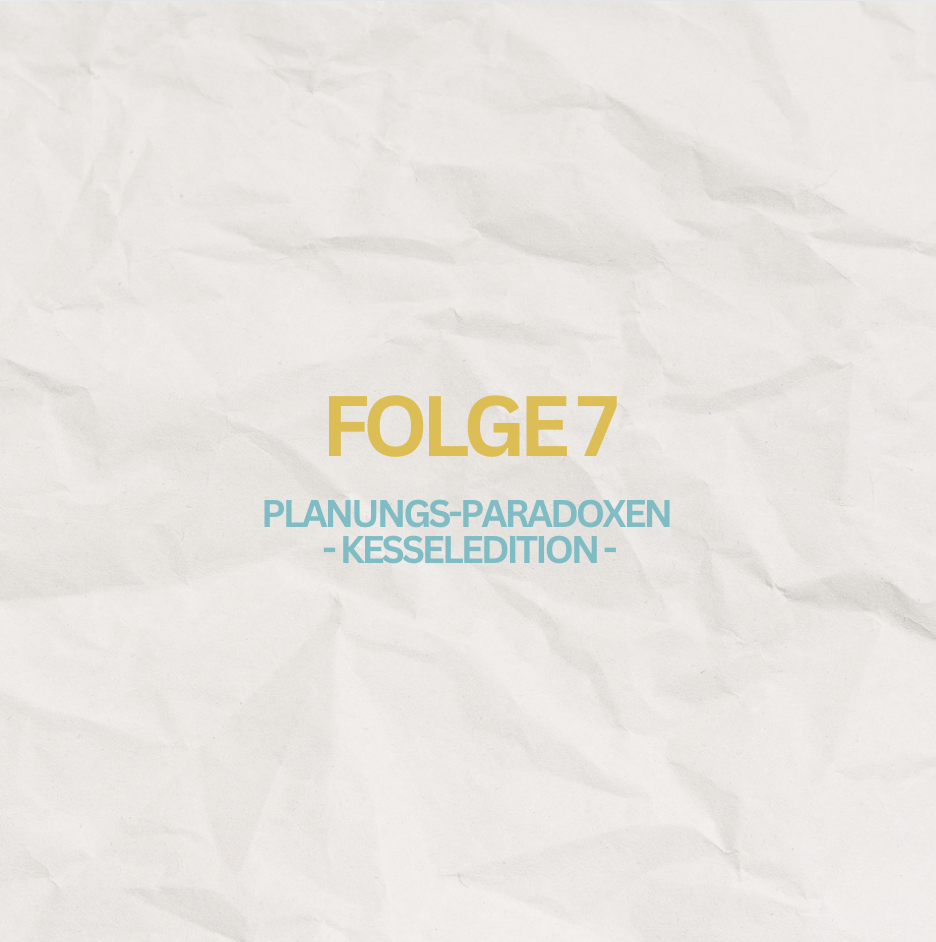Dani: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts „Zwischen Wort und Wirklichkeit“.
Frank: Heute widmen wir uns dem vielschichtigen Thema „Politik versagt“ – ein heiter-melancholisches Kuriositätenkabinett über Politikversagen, Gerüchte und die Wahrnehmung durch die Bevölkerung.
Dani: Wir sprechen auch darüber, wie Parteien mit Populismus umgehen und ihn nutzen, um ihre Ziele zu erreichen.
Frank: Im Plauderton entlarven wir die Scharlatane und reden über das sogenannte Planungs-Paradoxon.
Dani: Also, Frank, heute haben wir uns ja ein kniffliges Thema vorgenommen. Ich möchte da gleich mit der Tür ins Haus fallen – oder sollten wir eher sagen, mit dem Zebra in den Amtssitz? Wo siehst du die kuriosesten Beispiele, bei denen die Politik, nun ja, leicht daneben getreten ist?
Frank: Ach, Dani, da ist die Auswahl so bunt wie die Krawattenkollektion eines Parlamentsnarren. Wie wäre es mit dem Klassiker: Die Stadt, die Brücken baute, wo keine Flüsse sind, oder die neue Bibliothek ohne Bücher, weil das Geld für digitale Medien draufging – die natürlich keiner bestellen konnte, weil das dafür zuständige Amt noch analog unterwegs war?
Dani: Und wie steht es um diese ständigen Gerüchteküchen, Frank? Sind die manchmal nicht auch ein Ausdruck davon, dass die Politik an der Basis vorbeiredet?
Frank: Absolut, Dani. Wenn Parteien anfangen, ‚alternative Fakten‘ zu servieren, dann kochen die Gerüchte hoch wie ein überquellender Suppentopf. Da wird aus einer sachlichen Debatte schnell eine folkloristische Legendenbildung – und schon hat man einen Minotaurus im Parteiprogramm.
Dani: Butter bei die Fische, Frank. Populismus – manche Parteien nutzen ihn wie den Schlüssel zum Wählerherz. Können wir da nicht auch von einem Versagen sprechen?
Frank: Oh, gewiss. Populismus ist das rhetorische Fast Food der Politik – schnell konsumiert, leicht verdaulich und auf Dauer sehr schädlich. Ich erinnere mich an einen Wahlkampf, da versprachen sie dem Volk goldene Berge, die sich später als aufgehüpfte Maulwurfshügel entpuppten. Parteien, die den Populismus nutzen, machen oft das Versprechen zum Programm und die Entschuldigung zur Amtseinführung.
Dani: Das bringt uns direkt zu unserem Planungs-Paradoxon. Also, Frank, was meinst du – warum gelingt es oft nicht, die großartigen Manifeste in manifeste Großtaten zu verwandeln?
Frank: Das Planungs-Paradoxon, Dani – der Traum jedes Theoretikers und der Albtraum jedes Praktikers. Politik ist das Kunstwerk der Kompromisse und der langen Wege. Das ist wie ein Marathon. Man plant eine Autobahn und am Ende wird’s ein Trampelpfad. Denn genau da, wo Strategie auf Realität trifft, da passiert es: Satte Löwen des Wahlkampfes werden zu zahnlosen Tigern der Amtsstube. Ein prominentes Beispiel für ein Planungsparadoxon in Deutschland, das oft als Sinnbild für Politik gesehen wird, die an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger vorbeiplant, ist die Geschichte von Stuttgart 21.
Dani: oh stimmt – dazu kann ich was erzählen. Ich weiß noch wie ich 2006 nach Stuttgart in eine WG gezogen bin – mit Blick auf den Schlossgarten. Mein Mitbewohner meinte damals: ja, jetzt sieht das noch super aus – warte mal den Umbau vom Kopfbahnhofs in einen Durchgangsbahnhof ab. Ursprünglich sollten durch das Projekt die Kapazitäten des Bahnhofs erhöht, die Anbindung verbessert und gleichzeitig neue städtebauliche Impulse gesetzt werden. Die Planungen begannen in den 1990er-Jahren, und der Bahnhofsumbau hätte laut ersten Planungen bis zum Jahr 2019 abgeschlossen sein sollen.
Ich erinnere mich sehr gut wie um Stuttgart 21 eine heftige Debatte und ein starker Bürgerprotest entbrannte. Viele Stuttgarter empfanden das Projekt als eine Verschwendung von Steuergeldern und fühlten sich in die Entscheidungsprozesse nicht ausreichend einbezogen.
Frank: Das ist ja immer der große Klassiker. Übrigens ein kleines Bonbon nebenher – ich komme aus einer kleinen Stadt in Westfalen – da gibt es nicht nur keinen Kopfbahnhof, sondern da halten die meisten Züge noch nicht einmal.
Und das ist ein echtes Beispiel für dieses Paradoxon – die Politiker und die Verwaltungen planen da irgendwas – die geben das auch kund. Die hängen das in irgendwelche altmodischen Kästen rein – vielleicht sogar an eine Litfaßsäule oder der x-ten Unterseite einer Website steht dann was und keiner bekommt was mit. Für die Politikerinnen und Politiker und die Menschen in der Verwaltung ist ihre Arbeit dann getan. Rechtlich sind sie damit aus dem Schneider. Worüber sie sich keinen großen Kopf machen, ist es den Bürgern wirklich transparent zu erklären, was da auf die zukommt.
Dani: Absolut. Da müssen wir auch noch mal ganz strukturiert ran, was man da hätte besser machen können. Ich würde allerdings gerne noch mal auf ein Thema zurückkommen, was die Menschen damals sehr verärgert hat – das Thema „Verschwenden von Steuergeldern“, also das Thema Kosten, denn die sind ja im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen. Kennt man ja auch von anderen Projekten. Überraschung. Umweltschützer zeigten sich besorgt über die Auswirkungen auf den Schlossgarten, ein beliebtes Naherholungsgebiet, und über mögliche Folgen für das Grundwasser. Verkehrsexperten wiederum zweifelten an der versprochenen Kapazitätserhöhung und Effizienzverbesserung. Ich erinnere mich noch gut an “Der Zug ist dann 7 Min schneller in Ulm.”
Frank: Ja, und das für einen Unkostenbeitrag von mehreren Milliarden Euro. Da lohnt sich ja alles.
Dani: Genau 😅 Das ist heute natürlich, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, etwas anders. Wir sind jetzt ja aber noch mal in der Zeit kurz vor Baubeginn. Das zeigt doch wirklich gut die Schwierigkeiten im Zusammenspiel zwischen politischen Entscheidungsträgern, der Verwaltung und der Bevölkerung. Das Projekt gilt für viele als ein Lehrstück dafür, wie wichtig es ist, in der Politik den Dialog zu suchen, um gemeinschaftlich tragfähige Lösungen zu erarbeiten.
Frank: Einfach mal miteinander sprechen. Als du in Stuttgart gewohnt hast, war euch damals klar, dass Stuttgart einer der dreckigsten Städte Deutschlands ist? Durch die Kessellage, Feinstaubbelastung, ..
Dani: Tatsächlich habe ich mich damit erst mehr beschäftigt, als ich in die Politik gegangen bin. Da hatten wir richtig tolle Veranstaltungen für die Neumitglieder. Da wurde ich mal aufgeklärt, was diese Kessellage bedeutet. Als Bürger hätte man das nicht so mitbekommen.
Frank: Und dann hacken sie noch das letzte Stück Natur raus. Das ist schon echt Wahnsinn.
Bei dem Großprojekt Stuttgart 21 hätte die Politik verschiedene Ansätze verfolgen können, um die Umsetzung des Projekts zu verbessern und die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen.
Frühe und umfassende Bürgerbeteiligung: Die Politik hätte von Beginn an transparente und regelmäßige Informationsveranstaltungen und öffentliche Diskussionen durchführen können, um die Anwohner und Bürger über das Projekt zu informieren und deren Meinungen und Bedenken ernst zu nehmen. Eine echte und ernstgemeinte Bürgerbeteiligung hätte das Potential gehabt, Konsenslösungen zu finden und Widerstand zu reduzieren.
Dani: Ja! oder: Klare Kommunikation: Häufig wurden die Ziele und der Nutzen von Stuttgart 21 nicht klar genug kommuniziert. Die Politik hätte aufzeigen müssen, wie das Projekt konkret zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der städtischen Entwicklung beiträgt und welchen Mehrwert es für die Allgemeinheit bietet.
Und wie wäre es mit dem Thema Transparenz und Kosten? Eine realistische und transparente Darstellung der erwarteten Kosten und Risiken von Anfang an hätte das Vertrauen in die Planung des Projekts stärken können. Dies hätte auch geholfen, bessere finanzielle Reserven für unvorhersehbare Ausgaben einzuplanen.
Frank: Was bei solchen Projekten auch immer seeeehr wichtig ist: man braucht da schon eine frühzeitige und detaillierte Untersuchung der Umweltauswirkungen, auch unter Einbeziehung von externen Experten und der lokalen Umweltschutzverbände, das hätte die ökologische Vertretbarkeit des Projekts fördern können und eventuelle Kompensationsmaßnahmen festschreiben können. Und die Bürgerinnen und bürger hätten das dann eher verstanden… wenn man dann noch lokaler Expertise einbindet… Fachleute und Interessengruppen aus der Region hätten intensiver einbezogen werden können, um deren spezifisches Wissen und ihre Erfahrungen in den Planungsprozess einzubringen und das Projekt besser an die lokalen Bedürfnisse anzupassen.
Dani: Die Politik hätte ja auch mal – ganz objektiv – alternative Verkehrskonzepte, die eventuell weniger kostspielig oder invasiv gewesen wären, untersuchen und ernsthaft in Erwägung ziehen können.
Frank: Machen wir uns nichts vor – das war auch ein Presitge-Projekt. Gut, geholfen hätten auch regelmäßige Projektcontrolling und Anpassungsfähigkeit: Während der Umsetzung hätten regelmäßig Fortschrittskontrollen und Anpassungen erfolgen sollen, um flexibel auf Veränderungen und Herausforderungen zu reagieren. Ein agiles Projektmanagement hätte eventuelle Probleme frühzeitig erkennen und gegensteuern können.
Dani: Was auch immer hilft Mediation – nicht zu verwechseln mit der Meditation, die sicher auch an der ein oder anderen Stelle notwendig war ommmmm.
Frank: Ja, im Falle von Konflikten kann die Anwendung von Mediationsverfahren zwischen Betroffenen, Projektträgern und politischen Verantwortungsträgern helfen, einen konstruktiven Dialog aufzubauen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
Dani: Mensch Frank – diese ganzen Sachen hätten vermutlich viele Konflikte gemildert oder sogar vermieden werden können. Das hätte die Chance geboten, Stuttgart 21 als positives Beispiel für moderne Stadtentwicklung und Bürgergesellschaft zu etablieren. Hätte hätte Fahrradkette…
Frank: Das Szenario, bei dem Bürgerinnen und Bürger erst kurz vor Baubeginn eines Projektes auf die geplanten Maßnahmen aufmerksam werden und sich dagegen wehren, ist nicht unüblich in der öffentlichen Planung – vor allem bei Infrastrukturprojekten, die einen langen Planungshorizont haben und wo die aktive Bürgerbeteiligung erst spät einsetzt oder nicht kontinuierlich kommuniziert wird.
Dani: Ein solches Phänomen ist oft nicht nur auf ein Planungsparadoxon zurückzuführen, sondern auf Kommunikationsdefizite und mangelhafte Einbeziehung von Betroffenen während des Planungsprozesses. Und das ist Rotz! Das kann man besser machen. Wofür werden manche Menschen eigentlich bezahlt…?
Ich würde sagen, vielleicht kommen wir in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen noch mal auf ein paar solcher Beispiele.
Frank: Ja, das würde mich sehr freuen. Und vielleicht kann ich dann auch einen kleinen Monolog über die Bedeutung von Immanuel Kant in der heutigen Gesellschaft halten.
Dani: Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht – mal gucken.
Beide: Tschüüüüß
Weiterführende Informationen zur Episode
Was versteht man unter Planungsparadoxon?